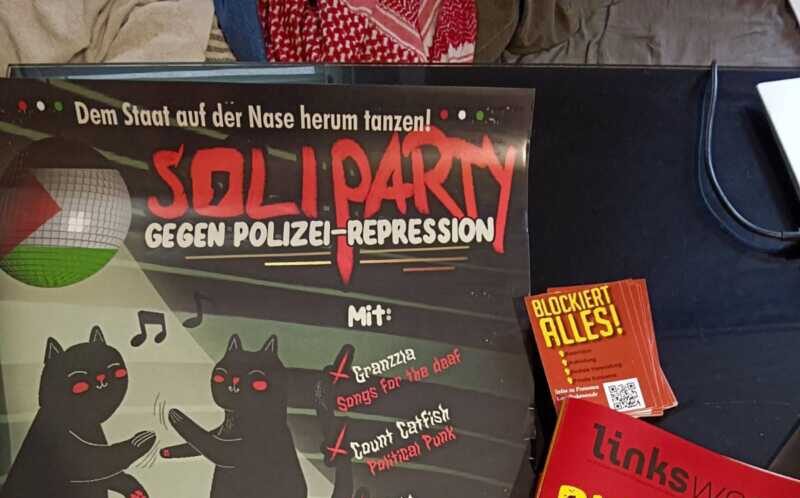Die Blütezeit marxistischer Parteiorganisation ist längst verstrichen. Heutzutage fragen sich viele: „Wo sind die Arbeitermassen, die Revolution machen sollen?“ Die Hürden für den Aufbau einer neu-erstarkten Arbeiter:innenbewegung liegen in den materiellen Bedingungen – durch die richtige revolutionäre Strategie, können sie aber überwunden werden!
Am 13. Juli 2024 verfehlte ein Schusswaffenanschlag den amerikanischen Präsidenten Donald Trump nur knapp. Das Attentat als politische Intervention ist wieder populär geworden – Firmenchefs, Politiker und Ideologen bangen angesichts der stets drohenden Gefahr vor Rache aus der Bevölkerung. Als Revolutionäre müssen wir uns aber klar darüber sein, dass individueller Terrorismus kein wirksames Instrument ist, um die kapitalistischen Ausbeutungsstrukturen ein für alle Mal zu beenden.
Es gibt keine Abkürzung zum Sozialismus
In Zeiten von niedriger Klassenaktivität, kommen linke Abenteurer gerne auf die Idee, man könne sich am Weg zum Sozialismus an der Arbeiterklasse vorbeischummeln.
Das 20. Jahrhundert ist gespickt mit „Heldenfiguren“, die auf eigene Faust oder durch die Organisierung einer militanten Minderheit den antikapitalistischen Kampf aufnahmen. Es einte sie die Überzeugung, im Gewehrlauf die Abkürzung zum Sozialismus gefunden zu haben, und dass sie sich mit der lästigen Arbeit der Arbeiter:innenorganisation gar nicht befassen müssen. Zu diesen Figuren zählen neben Einzeltätern wie Luigi Mangione, auch diverse Stadtguerilla, Terrororganisationen, wie die RAF und die antiimperialistischen Ikonen Che Guevara und Thomas Sankara. Leider sind unsere Abenteurer, wenn auch durchaus sympathisch, am Ende ihrer Geschichte immer durch den Staat ermordet worden oder landeten im Gefängnis. Tragischer noch: Zur tatsächlichen Ermächtigung der Arbeiter:innenklasse haben ihre wagemutigen Aktionen wenig bis gar nichts beigetragen. Wie Trotzki es formulierte: „Der Rauch der Verwirrung verpufft, es erscheint der Nachfolger des ermordeten Ministers, das Leben fällt zurück in den alten Trab der kapitalistischen Ausbeutung, die sich wie zuvor weiterdreht. Nur die Polizeirepression ist nun noch barbarischer.“ Der Aufbau einer revolutionären und proletarischen Bewegung ist nicht deswegen der Hauptfokus der Marxist:innen, weil Zeitungen verkaufen eine besonders spaßige Beschäftigung ist. Die Arbeiter:innenklasse ist die Klasse, die gesellschaftlichen Reichtum produziert. Darum kann sie als einzige Klasse die technische Entwicklung und Verteilung dieser Reichtümer demokratisch verwalten, vorausgesetzt sie schafft es, die Produktionsmittel unter ihre Kontrolle zu bringen. Wie bereits Marx formulierte: „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein.“
Die Arbeiterpartei und ihre Attrappen
Auf welche Klasse sich eine Partei stützt und welche Klasseninteressen eine Partei vertritt, gehen nicht notwendigerweise Hand in Hand. So kommt es, dass eine rechtsextreme Partei wie die FPÖ, die von sich behauptet die „Partei des kleinen Mannes zu sein“ und inzwischen tatsächlich unter den wählenden weißen Arbeiter:innen die stärkste Kraft ist, konsequent politische Maßnahmen zur Verschlechterung der Lebensbedingungen von Arbeiter:innen vorantreibt. Umgekehrt haben progressive Parteien wie LINKS und KPÖ große Schwierigkeiten zu einer relevanten Kraft innerhalb der Arbeiter:innenschaft zu werden. Diese Verwurzelung im Proletariat ist jedoch für jede Organisation, die den Kapitalismus ernsthaft herausfordern will, unerlässlich.
Eine wahrhaft sozialistische Partei zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Gesamtheit der Interessen der Arbeiter:innenklasse vertritt. Nicht das Schwenken roter Fahnen und keine noch so revolutionäre Rhetorik können als Beweis dafür herhalten: Messen muss man sie an ihren Taten. Interessen zu vertreten, bedeutet auch mehr, als eine Klasse lediglich zu repräsentieren, wie es etwa in einem sozialdemokratisches Parteienverständnis verankert ist. In den letzten Jahren verfolgt die SPÖ einen zunehmend rassistischen Kurs und hat nun sogar ein Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen für Mädchen unter 14 mitgetragen – ein erbärmlicher Versuch der inzwischen in Umfragen auf 37% gekletterten FPÖ das Wasser abzugraben. Natürlich sind auch innerhalb der Arbeiterschaft politische Ideen verbreitet, wie Rassismus, Leistungsdoktrin oder Konservativismus, die die Klasse spalten und ungerechte Eigentumsverhältnisse rechtfertigen. Das ist kein Wunder, schließlich haben die oberen sozialen Klassen einen viel besseren Zugang zu den Medien und Institutionen, die Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben. Gleichzeitig gibt es immer auch Arbeiter:innen, die erkennen, dass die Ursachen ihrer Ausbeutung und der globalen Krisen in der kapitalistischen Weltordnung liegen. Durch die Organisierung ihrer fortschrittlichsten Teile wird die revolutionäre Partei zu einem Instrument zur Selbstbefreiung der Arbeiter:innenklasse.
Massenpartei – noch modern?
Welche Form sollte aber eine solche revolutionäre Organisation annehmen? Sind Massenparteien nicht ein Relikt der Vergangenheit? Eine Studie der Freien Universität Berlin zeigt, dass Parteimitgliedschaft in Deutschland zwischen 1990 und 2010 um über 40 Prozent zurückgegangen ist. Dies hat unter anderem auch damit zu tun, dass ein Großteil der Menschen das Vertrauen in staatliche Institutionen und die liberal-bürgerlichen Parteien vollends verloren hat. Zum Glück zeigt die Geschichte, dass die Bereitschaft der Arbeiter:innen, sich in Parteien zu organisieren, sprunghaft ansteigen kann, wenn sie diese als ernsthafte Verkörperung ihrer Interessen erleben. Beispielsweise hatten die Bolschewiki 1914 gerade einmal 4.000 Mitglieder, nach der Februarrevolution 1917 kletterte diese Zahl auf 23.000 und im August desselben Jahres waren es 250.000. Auch heute ist ein solcher sprunghafter Anstieg in der Parteimitgliedschaft noch möglich, wenn eine Partei authentisch ist, zu den Arbeiter:innen spricht und von ihnen lernt, wie es etwa bei Syriza in Griechenland oder Podemos in Spanien der Fall war. Derzeit legt die von Jeremy Corbyn und Zarah Sultana initiierte Your Party in Großbritannien einen kometenhaften Aufstieg hin. Innerhalb einer Woche ihrer Gründung meldeten sich 700.000 Personen auf der Website an, um die neue linke Partei zu unterstützen. Zwar sind all diese Parteien nicht revolutionär in dem Sinn, dass sie eine ernsthafte Perspektive auf den Sturz des Kapitalismus eröffnen, im derzeitigen Stand des Klassenkampfes repräsentieren sie jedoch das fortschrittlichste Bewusstsein unter den Arbeiter:innen und die Hoffnung auf die Zerstörung des Bestehenden zu Gunsten einer sozialistischen Alternative.
Strategische Flexibilität
Die Hauptstärke der Bolschewiki lag in ihrer strategischen Flexibilität. In der Illegalität mussten sie als kleine Zirkel von Berufsrevolutionären agieren, die sich erst mit dem Aufstand von 1905 zur Massenpartei entwickelten. Es gibt kein vorgefertigtes Rezept für die ideale Organisationsform der Arbeiter:innenklasse, vielmehr leitet sich diese aus den materiellen Bedingungen ab, in denen sie agieren muss. Massenpartei oder konspirativer Zirkel, Parteipolitik, Gewerkschaftsarbeit oder Mobilisierung auf der Straße, Räteherrschaft oder strenger Zentralismus können die Instrumente sein, auf die eine revolutionäre Partei in einer konkreten historischen Situation zurückgreift, um die Ermächtigung der Arbeiter:innenklasse zu entwickeln. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen jedoch, dass gewisse organisatorische Grundsätze unabdingbar sind, damit eine Partei die Wogen revolutionärer und konterrevolutionärer Zeiten navigieren kann.
- Kaderisierung
Im Kapitalismus sind in der Arbeiter:innenklasse sowohl reaktionäre als auch revolutionäre Ideen verbreitet. Damit die revolutionären Ideen siegen können, müssen sich die fortschrittlichsten Teile der Arbeiter:innenklasse organisieren, um das politische Bewusstsein der gesamten Klasse zu heben. Dabei stehen die Revolutionäre nicht als Führer außerhalb der arbeitenden Massen, sondern sie gehen aus ihr hervor, werden beflügelt durch ihre spontane politische Kraft und treiben diese ins Maximum.
Hierfür braucht es ausgebildete Kader, die auf einen Erfahrungsschatz von Jahrhunderten von Klassenkampf zurückgreifen können. Menschen Bildung zu verwehren, heißt sie regierbar zu machen – das Gegenteil wollen Sozialist:innen. Ein hohes theoretisches Niveau ist darum für jede revolutionäre Gruppe unverzichtbar. Aber isoliert man sich dadurch nicht von den Arbeiter:innenmassen, die keine Zeit haben, jede Woche ein Buch zu lesen? Natürlich ist das Gespenst des kommunistischen Elfenbeinturms ein durchaus reales Phänomen, das vor allem auf den Universitäten umgeht und dort sein elitäres und manchmal narzisstisches Unwesen treibt. Im Unterschied dazu entwickeln revolutionäre Organisationen ein Wissen, das konstant mit den praktischen Erfahrungen der Arbeiter:innen und den aktuellen politischen Kämpfen in Verbindung gebracht wird. Die aktivistische Praxis stellt das erarbeitete Wissen auf die Probe und befruchtet zugleich die weitere theoretische Auseinandersetzung. Anstatt sich also von den gelebten Erfahrungen der Arbeiter:innen abzugrenzen, schmiedet sie es zur Waffe, mit der die Arbeiter:innen den Kampf gegen den Kapitalismus aufnehmen. Die „organischen Intellektuellen“, wie Gramsci sie nennt, kommen aus der Arbeiter:innenklasse, sprechen ihre Sprache und haben als Gruppe ein hohes theoretisches Niveau.
Das Lieblingsargument gegen Marxist:innen aus autonomen und anarchistischen Kreisen ist der Vorwurf, das Kaderprinzip wäre autoritär. In ihrer Vorstellung treffen dabei vereinzelte, hochausgebildete Funktionäre über die Köpfe aller anderen Mitglieder hinweg Entscheidungen, die diese dann widerspruchslos auszuführen hätten. Sie könnten falscher nicht liegen. Kaderisierung ist ein Bildungsprozess, den die Organisation permanent und kollektiv betreibt, und der die demokratische Teilhabe aller Mitglieder überhaupt erst ermöglicht. Autoritäre Tendenzen entstehen, wenn Organisationen ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen. Den Mitgliedern fehlen dann die nötigen Werkzeuge, um Diskussionen und Herausforderungen eigenständig zu navigieren. Dadurch geraten sie in völlige Abhängigkeit von der Anleitung langgedienter Funktionäre. Neben einer lebhaften Debattenkultur und der theoretischen Weiterbildung aller Mitglieder braucht es aber auch eine organisatorische Struktur, die die demokratische Kontrolle gewährleistet. - Demokratischer Zentralismus!
Ein gewisses Element des Zentralismus ist in allen Organisationsformen angelegt. Dass eine Gruppe von Personen als Kollektiv handelt und nicht als chaotischer Haufen von Individuen, die politische Entscheidungen auf der Grundlage von persönlichen Erfahrungen und ihrer Tagesverfassung treffen, ist genau was die Stärke von Organisierung ausmacht. Im Kapitalismus stehen wir Arbeiter:innen und Sozialist:innen einem hochzentralisierten Apparat gegenüber, dem bürgerlichen Staat, der die Herrschaft der Kapitalistenklasse in organisierter Weise aufrechterhält – etwa durch Gesetze und Polizeigewalt zum Schutz von Privateigentum. Würde sich die Bevölkerung beispielsweise gegen die Regierung erheben, kann eine Person, der Innenminister, alle Polizeikräfte des Landes dirigieren, um den Aufstand niederzuschlagen. Um es mit diesem System aufzunehmen, brauchen wir einen ebenso hochzentralisierten Apparat, der es uns ermöglicht, vereint als Klasse zurück zu schlagen. Damit der Zentralismus nicht in Autokratie umschwenkt, müssen Personen in Verantwortungspositionen jedoch den Interessen der Basis verpflichtet bleiben und absetzbar sein, wenn sie diese Verpflichtung nicht erfüllen. Zwei Tendenzen haben sich als besonders schädlich für linke Organisierung erwiesen:
Anarchistische Schattenherrschaft: Der in autonomen Kreisen verbreitete Zugang, alle Entscheidungen „im Konsensprinzip“ zu treffen, kann nie verhindern, dass sich Führungsfiguren etablieren. Es wird immer Personen geben, die länger aktiv sind, mehr Zeit und Ressourcen investieren können, oder sich in den Mittelpunkt drängen und Verantwortungen übernehmen. Das Leugnen der Existenz dieser Funktionäre führt schlicht dazu, dass sie keine Rechenschaft gegenüber dem Rest der Organisation ablegen müssen. Abgesehen davon, ist ein solcher Zugang für eine Massenorganisation undurchführbar. Wie sollen 250.000 Arbeiter:innen, über die Teilnahme an einer Demonstration „konsensual“ entscheiden?
Die zweite Tendenz, die jegliche Demokratie im Keim erstickt, ist Bürokratisierung. Sie entsteht durch Substitution: die Partei setzt sich an Stelle der Klassenaktivität, die Kader ersetzen die Beteiligung der Basis und in letzter Instanz substituiert der Diktator die Herrschaft der Arbeiter:innen. 1936 verfasste Leo Trotzki ein zentrales Werk, Verratene Revolution, in dem er anprangert, dass in der stalinistischen Sowjetunion eine neue Klasse von Parteibürokraten die Macht übernommen hat. Der Weg dorthin gestaltete sich über schwerwiegende Einschränkungen der innerparteilichen Demokratie – beispielsweise wurden Parteitage ohne vorhergehende Diskussion einberufen und Spitzenfunktionäre faktisch unabsetzbar gemacht.
Im demokratischen Zentralismus speist sich der Weg voran aus den Erfahrungen der Arbeiter:innen im Klassenkampf. Die Debatte ist dabei stets auf Aktivität gerichtet – eine revolutionäre Organisation ist schließlich kein endloser Diskussionszirkel zu Selbstbeschäftigungszwecken. Sie führt zu einem Beschluss, nachdem die Organisation geeinigt handeln kann. - Internationalismus
Der Kapitalismus ist ein weltumfassendes Wirtschaftssystem. Ihm gegenüber müssen wir die Arbeiterschaft als internationale Klasse setzen. Die Umsetzung von „Sozialismus“ in nur einem einzigen Land kann nicht gelingen, da ein solches Land weiterhin der Logik des internationalen Marktes unterworfen bleibt. Eine „Weltpartei des Proletariats“ ist zum jetzigen Zeitpunkt aber eine Illusion und kann auch nicht einfach aus dem Boden gestampft werden. Es müssen darum die revolutionären Organisationen der einzelnen Länder eng zusammenzuarbeiten, sich kontinuierlich über ihre theoretische und praktische Ausrichtung austauschen, und auf diese Weise schrittweise zu einer geeinten politischen Kraft formieren. Die langfristige Perspektive einer solchen Zusammenarbeit muss der Aufbau einer neuen Internationalen sein, die den globalen Sturz des Kapitalismus erzwingen kann.
Die Zersplitterung der Linken
„Was sind drei Trotzkisten in einem Raum? Eine 4. Internationale, eine 5. Internationale und eine 5. Internationale Linksopposition!“ Der Witz birgt eine schmerzhafte Wahrheit: Warum schafft es die Linke im 21. Jahrhundert nicht als geeinte Kraft aufzutreten? Die Ursachen für diese Misere liegen in der Geschichte. Die lebendige Arbeiter:innenbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierte, wurde in den 1920er und 1930er-Jahren, durch schreckliche Niederlagen – imperialistische Aggression, Faschismus und die stalinistische Herrschaft – zerschlagen. Trotzki hat den Niedergang der Bewegung in den 1930er-Jahren fälschlicherweise als eine Krise der Führung interpretiert und die 4. Internationale zu einem Zeitpunkt aufgebaut, als keiner der beteiligten Parteien eine relevante Verwurzelung in der Arbeiter:innenklasse hatte. Leider ist es für eine Handvoll Revolutionäre, mögen sie noch so schlau und strategisch sein, nicht möglich die geschlagene Arbeiter:innenkraft im Alleingang wiederaufzubauen, nur weil sie das wollen. Als nach dem Krieg, sowohl das imperialistische Weltsystem als auch die Sozialdemokratie und der Stalinismus „auferstanden aus Ruinen“ der Zerstörung, blieben die revolutionären Marxist:innen auf dem Trockenen. Die revolutionäre Linke tat sich schwer richtig an einer selbstbewussten Arbeiter:innenklasse anzudocken, die ausstrahlt: „Es geht uns immer besser, was interessiert uns eine Revolution.“ In den 1950er bis 1970er-Jahren waren die Klassenkämpfe deshalb meist offensiv – für höhere Löhne, weniger Arbeitszeit, bessere Bildung, etc. Gruppen, die da abseits standen und keine relevantes Betätigungsfeld fanden, schlitterten in Krisen und spalteten sich. Nicht jede Spaltung ist gerechtfertigt, oft handelt es sich um persönliche Zerwürfnisse, die Tony Cliff als „die größte Gefahr für kleine Gruppen im Aufbau“ beschrieb. Jedoch ist es auch die falsche Politik, Spaltung um jeden Preis zu vermeiden. Nicht weniger gefährlich ist es für eine Organisation, wenn sie einen opportunistischen Kurs fährt und der Harmonie willen toleriert, dass in ihren eigenen Reihen auch die Interessen anderer Klassen und Einzelpersonen vertreten werden. Sie ist dann kein wirksames Instrument zur Selbstbefreiung der Arbeiter:innenklasse mehr. Das heißt nicht, dass die geeinte revolutionäre Arbeiter:innenpartei für immer vom Tisch ist. Der Kapitalismus, mit seiner Ausbeutung und seinen Krisen produziert permanent auch Widerstände – ihre Formierung zur einheitlichen Kampforganisation kann in einer revolutionären Situation innerhalb weniger Wochen gelingen. Dafür müssen Organisationen jedoch lange zuvor Authentizität aufbauen, durch konsequente Politik, die Arbeiter:innenkämpfe beflügelt, anstatt sich zu isolieren.
Die Partei bei niedriger Klassenaktivität
Im jährlichen Durchschnitt verzeichnete Österreich von 2012-2021 nur einen Streiktag pro 1.000 Beschäftigte im Jahr und ist damit im europäischen Vergleich fast Schlusslicht. Für revolutionäre Organisationen bergen solche Zeiten niedriger Klassenaktivität eine Reihe von Gefahren, die sie von der Arbeiter:innenklasse trennen und in die Irrelevanz katapultieren können.
Sektenmentalität: Sozialist:innen sind im Kapitalismus einem konstanten Druck durch die bürgerliche Gesellschaft ausgesetzt: Bespitzelung durch den Staat, Lohnarbeitszwang, Verleumdungen, Kooptionsangebote können dazu führen, dass eingeschworene Gruppen falsche Verteidigungsstrategien dagegen entwickeln: unter sich bleiben, blindes Vertrauen in Funktionäre oder sich selbst als die Führer der Arbeiter:innenklasse haben, wenn es dafür in der Realität keine Grundlage gibt. Diese Abschottung von der Außenwelt erreicht ihren Höhepunkt, wenn ein Kollektiv gegenüber einer realen oder imaginierten Bedrohung durch den Staat ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht und dadurch ein „Klima der Angst“ schafft, das eine Beteiligung an den Aktivitäten der Gruppe von außen fast gänzlich verhindert.
Verabschiedung von Arbeiter:innenkämpfen: Selbstverständlich liegt in gesellschaftlichen Kämpfen, wie in der Solidaritätsbewegung mit Palästina, im Antifaschismus und im Kampf um Transrechte ein explosives und ermächtigendes Potential und eine revolutionäre Partei muss diese zur maximalen Schlagkraft treiben, schon allein, weil sie die Befreiung aller Unterdrückten fordert. Frustration über fehlendes Klassenbewusstsein kann aber dazu führen, dass Gruppen die Arbeiter:innenklasse als Ganzes aufgeben und sich vollends von sozialen Bewegungen mitreißen lassen. Ohne die übergeordnete Perspektive den Kapitalismus mit Arbeitermacht zu bezwingen, führen diese Kämpfe allerdings in Leere oder bestenfalls zu kleinen Verbesserungen für Teile der Gesellschaft, die die grundlegenden Mechanismen der Unterdrückung unangetastet lassen.
In Zeiten niedriger Klassenaktivität muss die Partei also Abschottungstendenzen mit aller Kraft entgegenwirken und durch den Aufbau von Revolutionären das Bewusstsein der Klasse als Ganzes heben. Soziale Kämpfe müssen geführt und mit den Kämpfen der Arbeiter:innenklasse verbunden werden, um den Widerstand gegen die Unterdrückung zu vereinigen. Der marxistische Theoretiker John Molyneux formulierte:
„In Zeiten kapitalistischer Stabilität, wenn die Arbeiterklasse für das System keine Gefahr darstellt, fallen Theorie und Praxis notgedrungen auseinander. Unter solchen Umständen können höchstens erste Schritte für den Aufbau einer revolutionären Partei unternommen werden. Sie wird daher vorläufig eine abstrakte Notwendigkeit bleiben. Aber wenn das System wie heute von einer schweren Krise erschüttert wird, dann können Theorie und Praxis zusammenkommen und der Parteiaufbau wird von einer abstrakten Bestrebung zu einer praktischen Notwendigkeit und realen Möglichkeit.“