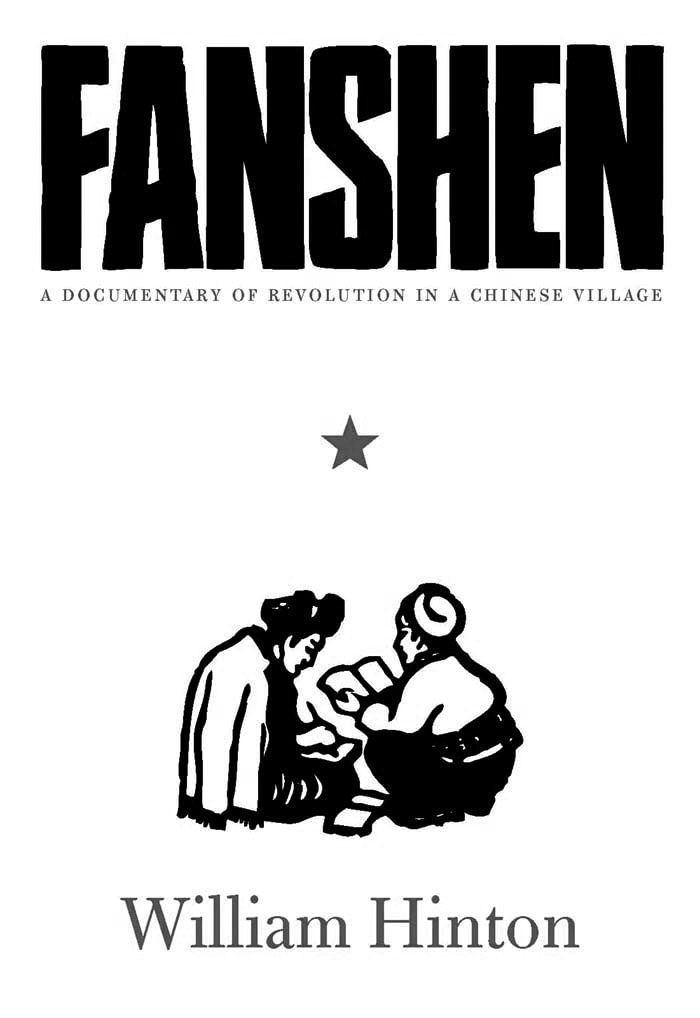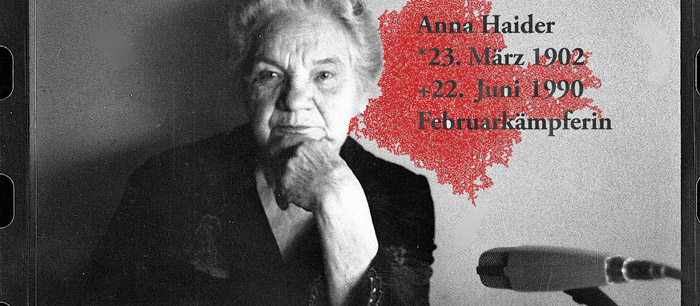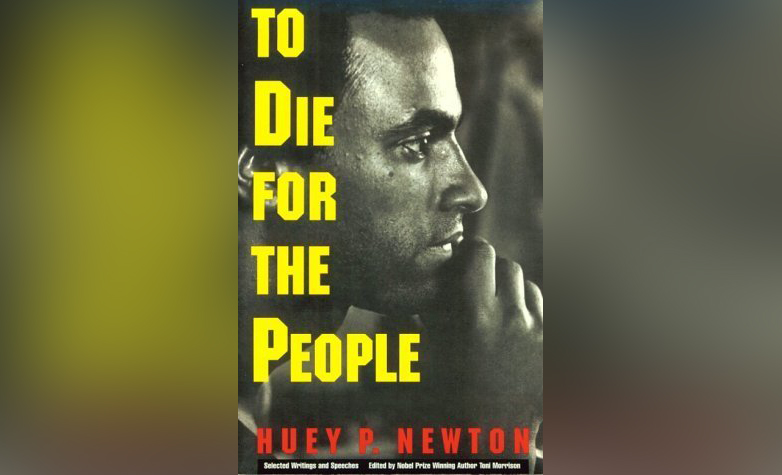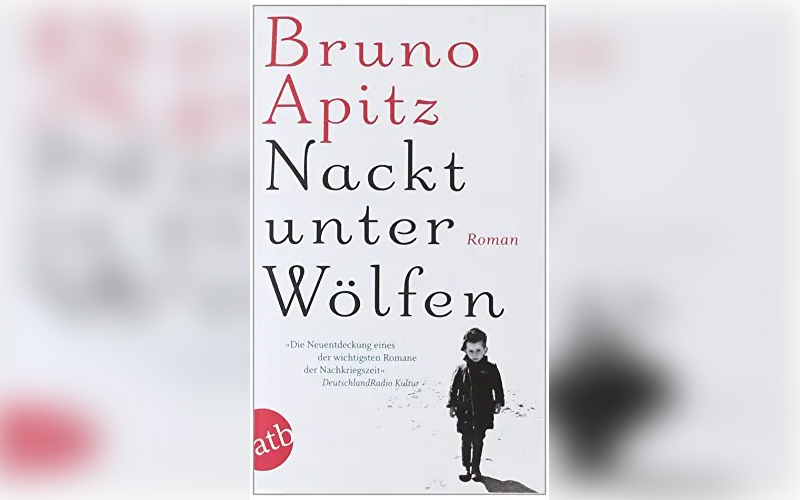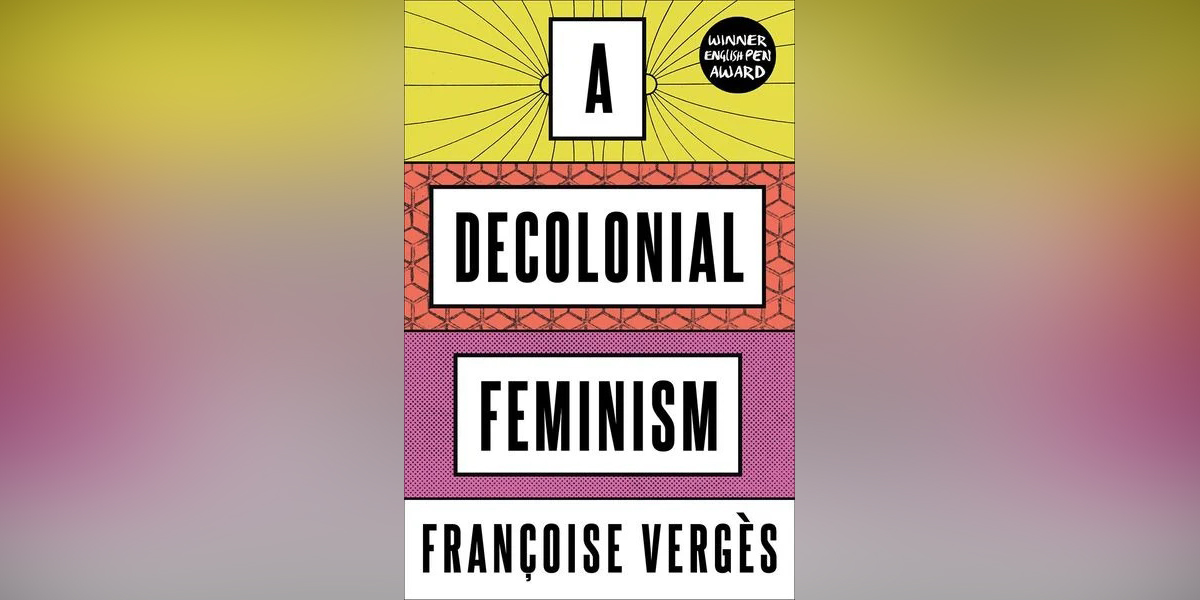Mit dem Essayband Weiß präsentiert sich Bret Easton Ellis, Autor des Kultromans American Psycho, wie man es von ihm gewohnt ist: angriffig und höchst unmoralisch – und liefert dabei ein Sittenbild der amerikanischen Gesellschaft.
Es gibt weder moralische noch unmoralische Bücher. Bücher sind gut oder schlecht geschrieben. Sonst nichts.“ Dieser Satz aus der Vorrede zu Oscar Wildes Roman Das Bildnis des Dorian Gray könnte auch von Bret Easton Ellis stammen. Der hat mit Weiß eine bissige Polemik gegen die Politische Korrektheit und die Millennials – die Generation der ständig Beleidigten, der „Generation Weichei“, wie er es nennt – vorgelegt. Wie Wilde plädiert Ellis für die absolute Freiheit der Kunst und sieht diese eng verknüpft mit Meinungsfreiheit – beides leide jedoch am Zwang der Politischen Korrektheit, die jede Kritik im Keim ersticke und damit eine zur Konformität verdammte Kulturlandschaft zurücklasse.
Harte Worte. Aber dafür ist Ellis bekannt. Anfang der 1990er schockierte er mit American Psycho, wo er mit dem Protagonisten Patrick Bateman zwischen Wall Street und gewaltpornografischer Serienmorde die Oberflächlichkeit der amerikanischen Gesellschaft parodiert. In den letzten Jahren provozierte er in seinem Podcast oder tobte twitternd durchs Netz (wo er betrunken auch mal aus Versehen Drogen bestellt).
Misstrauen statt Verachtung
In Weiß präsentiert sich uns nicht nur der Provokateur, der Ellis bewusst und gerne ist. Der Essayband liefert eine amerikanische Kulturgeschichte, die Ellis klug kommentiert und aus der Analyse einzelner Filme Thesen zum gesamtgesellschaftlichen Zustand aufstellt. Diese hangeln sich entlang an autobiografischen Reflektionen zu Ellis’ eigenen Werken, Erfahrungen und auch Fehlern. Durchaus witzig berichtet er von berühmten Bekanntschaften, wie die mit Kanye West (dessen ebenfalls nicht immer ganz politisch korrekte Tweets er als „dadaistische Performancekunst“ feiert – angesichts der fanatischen Begeisterung Kanyes für Trump eine etwas zu kurz greifende Erklärung…) und erzählt Anekdoten aus dem Zusammenleben mit seinem Lebensgefährten, der – ausgerechnet – ein Millennial ist. Bemerkenswert ist, dass Ellis trotz aller Kritik nie verurteilt. Er misstraut, verachtet aber nicht. Gerade das Kapitel über Identitätspolitik zeigt das. Er kritisiert einerseits, dass dabei den Menschen scheinbar unüberbrückbare Merkmale zugeschrieben würden, die sie automatisch in eine Opferrolle drängen, und ihre Diskriminierung in der eigenen Identität und nicht in den Gesellschaftsverhältnissen gesucht werden. Andererseits zeigt er durchaus Verständnis: „Es steht ihnen frei zu tun, was sie für richtig halten, und als Freund unterstütze ich sie.“
Leben und leben lassen, ist Ellis‘ Devise. Zwar stichelt er unaufhörlich (und schmeißt etwas zu oft mit dem Begriff „Faschismus“ um sich), vor allem gegen die Generation der Millennials. Ihre Unsicherheit und Verletzlichkeit nerven ihn, aber gleichzeitig spricht er ihnen sein Mitleid aus: dafür, dass sie den amerikanischen Traum schon bei ihren Eltern zerplatzen sahen, dass sie nicht einmal mehr mit ihrem Erfolg – wie sein Albtraum-Alter Ego Bateman – angeben können, weil der Hedonismus vom heldenhaften Verzicht abgelöst wurde.
Plädoyer gegen die Eindeutigkeit
Das wirkt natürlich etwas überheblich. Aber das ist wohl auch die erwünschte Wirkung. Nichts scheint Ellis mehr zu nerven als die Sehnsucht der Menschen nach eintöniger Positivität. Zuerst wollten sie die Künstler_innen nur noch als moralisch einwandfrei sehen und ignorierten ihre Fehltritte. Dann wurden alle selbst zu diesen Schauspielern und inszenierten auf allen Kanälen ihr perfektes Dasein. Ellis provoziert eine Welt, die ihre eigene Widersprüchlichkeit nicht mehr verkraftet, sie deshalb ausblendet oder photoshopt. „Es gibt in unserer Gesellschaft das zunehmende Problem, dass Menschen zwei einander widersprechende Gedanken im Kopf nicht mehr ertragen können.“ Ellis will diese Widersprüche als Kern des Lebens zeigen. Er ist nicht einfach nur der alte Herr, der sich über die heutige Jugend aufregt. Er versucht, sie zu verstehen. So hetzt er auch nicht gegen Trump-Wähler, sondern fächert das Bild einer Gesellschaft auf, die anfällig sein MUSS für einen, der sich nicht an die längst als Heuchelei entlarvten Verhaltensregeln der Politik hält, sondern darauf scheißt – und damit paradoxerweise für viele ehrlich erscheint.
Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was in Weiß zu lesen ist. Manches muss man kritisieren. Und nicht nur einmal schleicht sich leise die Ahnung zwischen die Zeilen, dass Ellis genau das beabsichtigt.