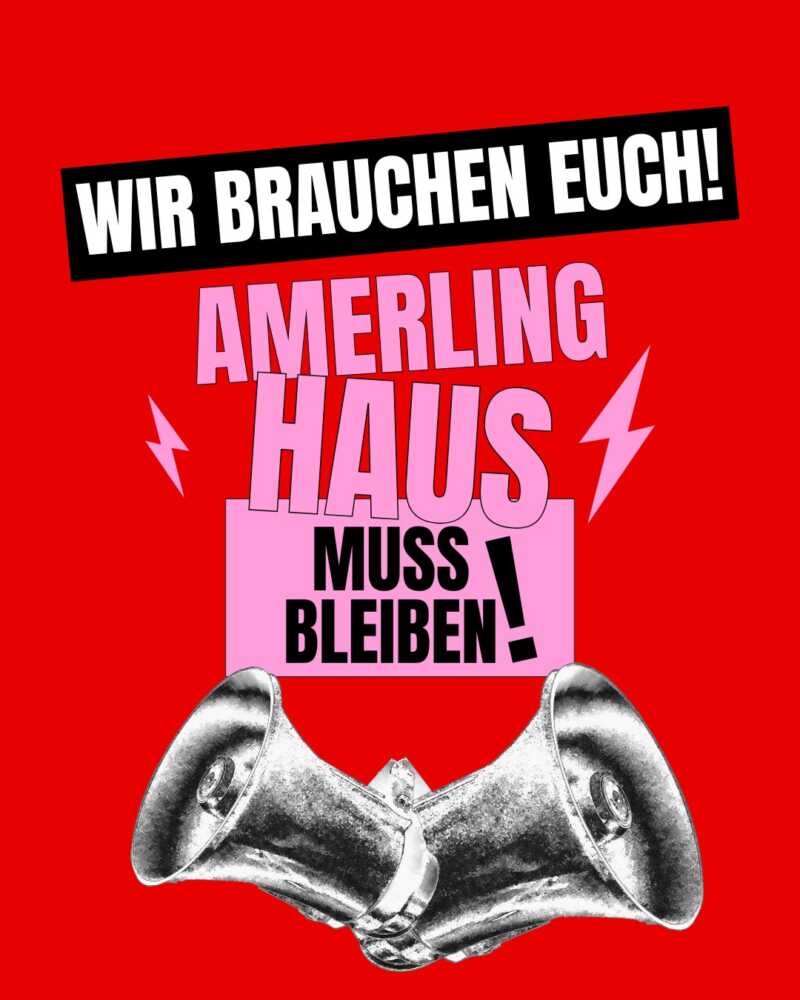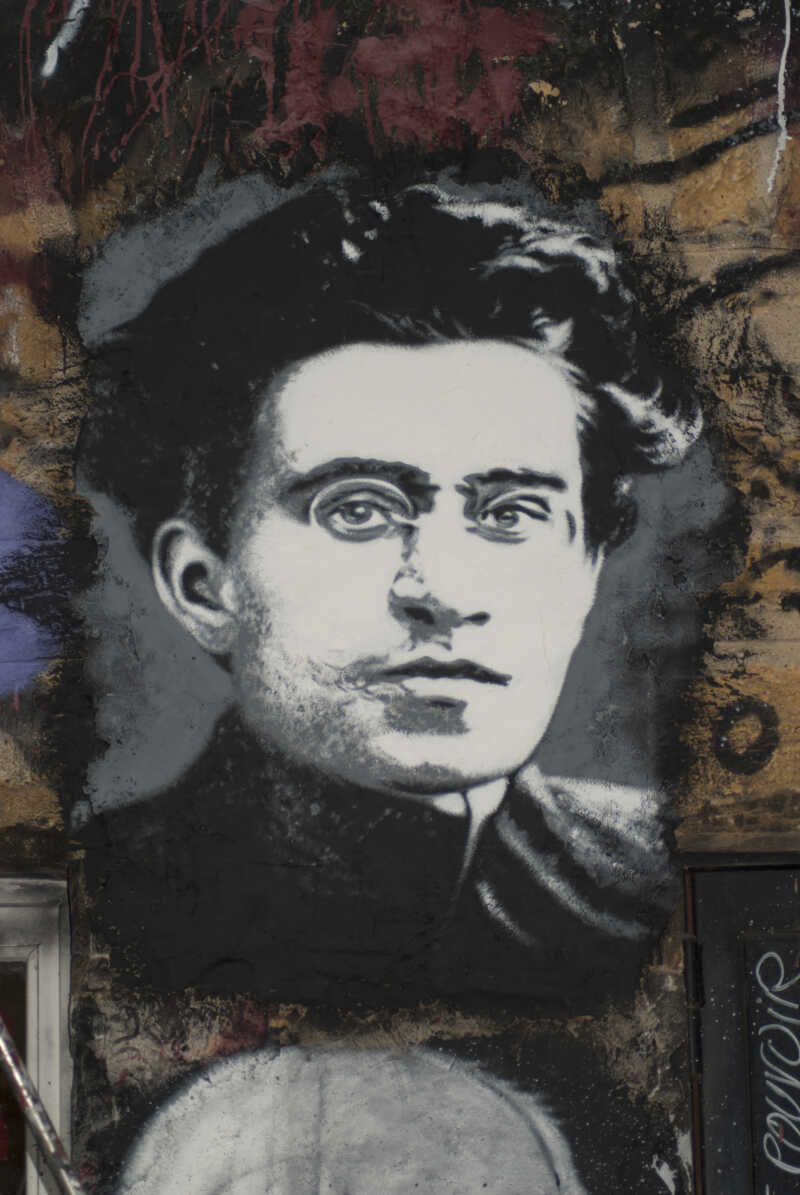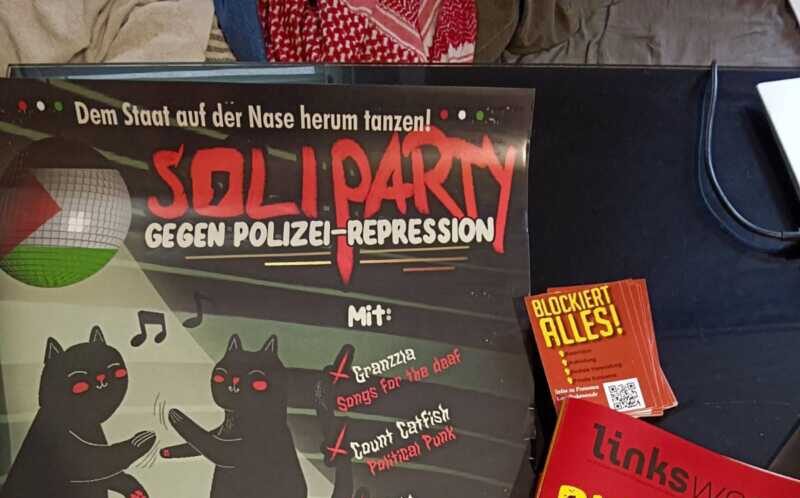Koloniale Besiedlungsprojekte, die auf die dauerhafte Kontrolle von Land und Ressourcen abzielten, sind untrennbar mit Gewalt verbunden. Im Gegensatz zu anderen Formen imperialer Herrschaft, die oft indirekt durch lokale Eliten ausgeübt wurden, basierten diese Besiedlungen auf der physischen Verdrängung der einheimischen Bevölkerung. Gewalt war dabei keine zufällige Begleiterscheinung, sondern ein zentrales Mittel zur Durchsetzung der kolonialen Ordnung.
Die einheimische Bevölkerung, mit ihrer tiefgreifenden Verbindung zu ihrem Land, stellte für die Kolonialherren eine existenzielle Herausforderung dar. Gewaltsame Besiedlung rief immer Widerstand hervor. Um diesen zu brechen, griffen die Kolonialmächte zu brutalen Maßnahmen wie Massakern, Zwangsvertreibungen und der Zerstörung ganzer Gemeinschaften. Diese Gewalt diente nicht nur der Unterdrückung, sondern sollte auch die koloniale Kontrolle festigen.
Ein wesentlicher Grund für die Anwendung extremer Gewalt war das zahlenmäßige Ungleichgewicht. Die Kolonisatoren waren meist eine kleine Minderheit, die einer deutlich größeren indigenen Bevölkerung gegenüberstand. Um ihre Herrschaft zu sichern, mussten sie auf militärische Macht und systematische Repression zurückgreifen.
Genozid an den Herero und Nama
Neben der Rolle als politisches Unterdrückungsinstrument wurde Gewalt auch eingesetzt, um die ökonomischen Ziele der Kolonialmächte zu erreichen: Die einheimische Bevölkerung wurde oft gezwungen, für die Kolonialherren zu arbeiten, sei es in Minen, auf Plantagen oder an Infrastrukturprojekten.
Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) war zwischen 1884 und 1915 eine Kolonie des Deutschen Kaiserreichs und Schauplatz eines der grausamsten Kolonialverbrechen der Geschichte: dem Genozid an den Herero und Nama. Die Ereignisse zwischen 1904 und 1908 markieren einen Höhepunkt kolonialer Gewalt.
Landnahme und Unterdrückung
Bereits ab den 1890er Jahren wurde die indigene Bevölkerung Deutsch-Südwestafrikas Opfer kolonialer Enteignung. Die Herero, die als Viehzüchter eine zentrale Rolle in der lokalen Wirtschaft spielten, wurden durch Landenteignungen und wirtschaftlichen Druck in Armut und Abhängigkeit gedrängt. Deutsche Kolonialherren eigneten sich nicht nur riesige Ländereien an, sondern zwangen die indigene Bevölkerung in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, die oft mit Gewalt durchgesetzt wurden.
Ein brutales Beispiel dieser Gewalt war die öffentliche Bestrafung von Herero-Arbeitern, die als „faul“ galten. Viele von ihnen wurden ausgepeitscht oder öffentlich gehängt, um andere einzuschüchtern. Besonders grausam war die Praxis, Herero-Familien zu zwingen, bei der Hinrichtung ihrer Angehörigen zuzusehen, bevor sie selbst als Zwangsarbeiter auf die Farmen der deutschen Siedler geschickt wurden.
Der Herero-Aufstand von 1904
Diese Missstände führten 1904 zu einem großangelegten Aufstand der Herero unter der Führung von Samuel Maharero: Die Herero griffen deutsche Siedlungen an und töteten rund 120 deutsche Männer, während Frauen und Kinder größtenteils verschont blieben. Die deutsche Kolonialverwaltung reagierte darauf mit einer brutalen militärischen Strafexpedition unter General Lothar von Trotha, die eine weitere Eskalation der Gewalt in Gang setzte.
Von Trotha setzte gezielt auf eine Politik der völligen Vernichtung, die keinen Unterschied zwischen bewaffneten Aufständischen und Zivilisten machte. In einem Befehl hieß es:
„Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.“
Ein grausames Beispiel für diese Politik war das Massaker am Waterberg. Nach der Niederlage der Herero-Truppen wurden Tausende von Männern, Frauen und Kindern in die Omaheke-Wüste getrieben. Um sicherzustellen, dass niemand entkommen konnte, errichteten Deutsche Truppen Sperrposten um die Wüste.
Konzentrationslager
Die Nama, ein weiteres indigenes Volk, erhoben sich 1905 ebenfalls gegen die deutsche Herrschaft. Ihre Revolte wurde mit ähnlicher Brutalität niedergeschlagen. Nama, die gefangen genommen wurden, wurden in Konzentrationslager deportiert, darunter das berüchtigte Lager auf der Haifischinsel vor der Küste von Lüderitz. Gefangene mussten unter freiem Himmel schlafen, wurden gezwungen, schwere Arbeit zu verrichten, und erhielten kaum Nahrung oder medizinische Versorgung. Krankheiten wie Typhus und Malaria breiteten sich ungehindert aus. Das ließ die Sterberate auf über 70 Prozent steigen.
Die Kolonialmacht ging bewusst grausam vor, um die einheimische Bevölkerung zu brechen. Deutsche Offiziere führten regelrechte „Menschenjagden“ durch, bei denen Nama und Herero verfolgt und getötet wurden. Oftmals wurden die Leichen der Toten zur Abschreckung an Bäumen aufgehängt oder entlang der Straßen liegen gelassen.
Wissenschaftlicher Rassismus
Ein weiteres Kapitel dieser Zeit war die pseudowissenschaftliche Praxis, Schädel und Knochen von ermordeten Herero und Nama nach Deutschland zu schicken. Diese Überreste wurden für rassistische Forschung verwendet, welche die angebliche Überlegenheit der europäischen „Rasse“ belegen sollten.
Den Deutschen ging es nicht nur um „Wissenschaft“. Gefangene wurden gezwungen, die Schädel ihrer getöteten Verwandten zu reinigen, bevor sie nach Deutschland verschifft wurden. Diese Verbrechen verdeutlichen die systematische Demütigung der indigenen Bevölkerung und die brutale Ideologie, die das koloniale Projekt prägte.
Konsequenzen und Vermächtnis
Der Genozid an den Herero und Nama führte zur fast vollständigen Vernichtung beider Bevölkerungsgruppen. Schätzungen zufolge starben rund 80 Prozent der Herero (etwa 80.000 Menschen) und 50 Prozent der Nama (etwa 10.000 Menschen) während des Genozids. Die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen der Überlebenden wurden zerstört und ihre Nachkommen leiden bis heute unter den Folgen dieser Gewalt.
Historiker argumentieren, dass die Erfahrungen deutscher Offiziere in den Kolonien – insbesondere die Konzentrationslager – Einfluss auf die Entwicklung des NS-Regimes hatten.
Aufstand in Indien
Der „Sepoy-Aufstand“ von 1857, oft auch als „Indische Rebellion“ bezeichnet, war eine der bedeutendsten Erhebungen gegen die britische Herrschaft in Indien. Die brutale Niederschlagung durch die Briten offenbarte die systematische Gewalt, welche für die koloniale Kontrolle unabdingbar war und hinterließ tiefe Wunden in der indischen Gesellschaft. Karl Marx nannte die Ereignisse einen Ausdruck der historischen „Vergeltung“, bei der die Brutalität der Kolonialherren auf sie selbst zurückfiel.
Die Rebellion hatte komplexe Ursachen – darunter wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Spannungen. Die britische Ostindien-Kompanie hatte durch Landenteignungen, Eingriffe in die sozialen und religiösen Strukturen und drakonische Steuermaßnahmen die Lebensgrundlage der indischen Bauern zerstört. Diese Entwicklungen führten dazu, dass indische Infanteristen, die in der britischen Armee dienten (die sogenannten Sepoys), zum Aufstand riefen.
Am 10. Mai 1857 begannen die ersten Revolten in Meerut, bevor sie sich rasch auf andere Teile Nord- und Zentralindiens ausweiteten. Der Widerstand richtete sich gegen die britische Unterdrückung, aber auch gegen lokale Eliten, die mit der Kolonialmacht kooperierten. Städte wie Delhi, Kanpur und Lucknow wurden zu Zentren der Aufstandsbewegung.
Marx über die Gewalt auf beiden Seiten
Die britische Reaktion war gnadenlos. Nach der Rückeroberung von Delhi im September 1857 wurden tausende von Aufständischen und Zivilisten ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Viele wurden öffentlich gehängt und die Stadt systematisch geplündert. In Kanpur verübten britische Truppen ein Massaker an indischen Männern, Frauen und Kindern, das als Vergeltung für die Tötung britischer Zivilisten dargestellt wurde.
Karl Marx beschrieb in einem seiner Artikel über den Aufstand die Grausamkeit sowohl der Aufständischen als auch der britischen Kolonialherren. Er stellte jedoch klar, dass die Gräueltaten der Sepoys eine Reflexion der kolonialen Gewalt waren, die die Briten über Jahrzehnte hinweg praktiziert hatten:
„Wie schändlich das Vorgehen der Sepoys auch immer sein mag, es ist nur in konzentrierter Form der Reflex von Englands eigenem Vorgehen in Indien nicht nur während der Zeit der Gründung seines östlichen Reiches, sondern sogar während der letzten zehn Jahre einer lang bestehenden Herrschaft. Um diese Herrschaft zu charakterisieren, genügt die Feststellung, daß die Folter einen organischen Bestandteil ihrer Finanzpolitik bildete. In der Geschichte der Menschheit gibt es so etwas wie Vergeltung; und es ist eine Regel historischer Vergeltung, daß ihre Waffen nicht von den Bedrückten, sondern von den Bedrückern selbst geschmiedet werden.“
Langfristige Folgen des Aufstands
Nach der Niederschlagung des Aufstands wurden die Verwaltungsstrukturen Indiens grundlegend verändert. Die britische Ostindien-Kompanie wurde aufgelöst, und die Kontrolle über Indien ging direkt an die britische Krone über. Königin Victoria versprach in ihrer Proklamation von 1858 eine gerechtere Behandlung der indischen Bevölkerung, doch diese koloniale Herrschaft war auf ihre Art mindestens genauso brutal. Die Rebellion hatte auch tiefgreifende psychologische Auswirkungen: Während die Briten die indische Bevölkerung zunehmend als Bedrohung wahrnahmen und ihre Kontrolle verschärften, entwickelte sich unter den Indern ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer organisierten Widerstandsbewegung. Der Aufstand von 1857 gilt daher als wichtiger Meilenstein in der indischen Freiheitsbewegung.
Algerien: Widerstand und Gewalt
Die französische Kolonialherrschaft in Algerien war von brutaler Gewalt und systematischer Unterdrückung geprägt. Schon seit der Eroberung Algeriens 1830 setzte Frankreich auf militärische Übergriffe, Massaker und Zwangsmaßnahmen, um sich die Kontrolle über das Land und seine Bevölkerung zu sichern. Die koloniale Herrschaft basierte nicht nur auf physischer Gewalt, sondern auch auf der systematischen Demütigung und Entmenschlichung der algerischen Gesellschaft.
Bereits mit der Eroberung 1830 begann der lang anhaltende Widerstand der einheimischen Bevölkerung gegen die französische Kolonialmacht. Die Gewalt erreichte ihren Höhepunkt während der algerischen Unabhängigkeitsbewegung in den 1950er Jahren.
Am 8. Mai 1945, während Europa das Ende des Zweiten Weltkriegs feierte, versammelten sich tausende Algerier in der Stadt Sétif, um für die Unabhängigkeit ihres Landes zu demonstrieren. Die Demonstrationen begannen friedlich, wurden jedoch bald blutig, als französische Truppen und Siedler das Feuer auf die Menge eröffneten. In Reaktion kam es zu Angriffen auf französische Siedler. Schätzungen zufolge wurden als Rache dafür zwischen 15.000 und 45.000 Algerier von französischen Truppen ermordet.
Die koloniale Gewalt endete aber nicht in Algerien selbst. Während des Algerienkriegs (1954–1962) wurden auch in Frankreich selbst Massaker an der nordafrikanischen Bevölkerung verübt. Am 17. Oktober 1961 protestierten tausende Algerier in Paris gegen eine Ausgangssperre, die speziell gegen sie verhängt worden war. Die französische Polizei unter Maurice Papon reagierte mit brutaler Gewalt. Schätzungen zufolge starben an diesem Tag bis zu 300 Menschen. Die Ereignisse in Paris zeigen, wie die koloniale Gewalt einer Fremdherrschaft mittels Rassismus auch die Gesellschaft zuhause prägt.
Die brutale Repression in Algerien und Frankreich führte letztlich nicht zur Stabilisierung der Kolonialherrschaft. Stattdessen radikalisierte sie die Unabhängigkeitsbewegung und führte zu internationalem Druck auf Frankreich, Algerien die Unabhängigkeit zu gewähren. 1962 wurde Algerien schließlich unabhängig, doch die Wunden der kolonialen Gewalt wirken bis heute nach.
Genozid an den Aborigines
Die Ankunft der First Fleet in Australiens Sydney Cove 1788 markierte den Beginn eines neuen Zeitalters für die Aborigines, eines Zeitalters von Vertreibung und Gewalt. Die britische Regierung betrachtete Australien als „terra nullius“ (Land ohne Besitzer), ignorierte die Rechte der indigenen Bevölkerung und begann mit der Landnahme. Viele Aborigines wurden erschossen oder vergiftet. Besonders berüchtigt war die Praxis, Brot mit Arsen zu vergiften und es an Aborigines zu verteilen.
Die Gewalt gegen Aborigines hatte verheerende demografische, soziale und kulturelle Folgen. Schätzungen zufolge wurde die indigene Bevölkerung Australiens von etwa 750.000 vor der Ankunft der Briten auf weniger als 100.000 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dezimiert.
In regelmäßigen Eskalationen massakrierten Siedler und Soldaten gezielt ganze Gemeinschaften. Einige der bekanntesten Massaker umfassen:
- 1.Das Myall-Creek-Massaker (1838):
Bei diesem Angriff töteten elf europäische Siedler mindestens 28 unbewaffnete Aborigines, darunter Frauen und Kinder. Obwohl einige der Täter vor Gericht gestellt und hingerichtet wurden, blieb dies eine Ausnahme in der australischen Kolonialgeschichte. - Das Pinjarra-Massaker (1834):
Im heutigen Western Australia griffen britische Soldaten und Siedler eine Gruppe von Bindjareb-Aborigines an und töteten bis zu 80 Menschen. Der Angriff wurde als „Strafexpedition“ gegen die indigene Bevölkerung gerechtfertigt. - Das Waterloo-Creek-Massaker (1838):
Im Bundesstaat New South Wales führte eine paramilitärische Polizeieinheit einen Angriff durch, bei dem Hunderte von Aborigines getötet wurden. Die genauen Opferzahlen bleiben unklar, da die Toten oft nicht dokumentiert wurden. - Das Coniston-Massaker (1928):
Dies war eines der letzten dokumentierten Massaker an Aborigines in Australien. Es folgte der Vergeltung für den Mord an einem europäischen Siedler und führte zur Tötung von mindestens 31 Aborigines durch Polizeikräfte und bewaffnete Zivilisten.
Kulturelle Vernichtung
Neben den Massakern führten die britischen Kolonisatoren systematische Zwangsumsiedlungen durch. Die Aborigines wurden von ihrem Land vertrieben und in sogenannte „Missionsstationen“ gebracht, wo sie unter der Kontrolle der Kolonialverwaltung standen. Diese Umsiedlungen zerstörten die traditionellen Lebensweisen und sozialen Strukturen der Aborigines. Kinder wurden in großer Zahl ihren Familien entrissen und in staatliche oder kirchliche Heime gebracht. Diese Generationen, bekannt als die „Stolen Generations“, erlitten einen kulturellen und emotionalen Verlust, der bis heute Auswirkungen auf die indigene Gemeinschaft hat. Die Massaker an den Aborigines und die Gewalt, die den Kolonialismus weltweit prägte, stehen sinnbildlich für die Zerstörung indigener Kulturen und die brutale Durchsetzung imperialer Interessen. Von Deutsch-Südwestafrika bis Australien setzten die Kolonialmächte auf Repression und Vernichtung, um ihre Herrschaft zu sichern. Doch diese brutalen Strategien konnten den Widerstand der unterdrückten Völker nicht brechen. Trotz unermesslicher Verluste bewiesen die Aborigines, die Herero, die Nama und viele weitere Völker enorme Widerstandskraft. Ihr unermüdlicher Kampf untergrub die Legitimität der Kolonialmächte und führte letztlich zum Scheitern dieser Systeme. Die Überlebenden und ihre Kulturen erinnern uns daran, dass koloniale Unterdrückung niemals verziehen werden darf.