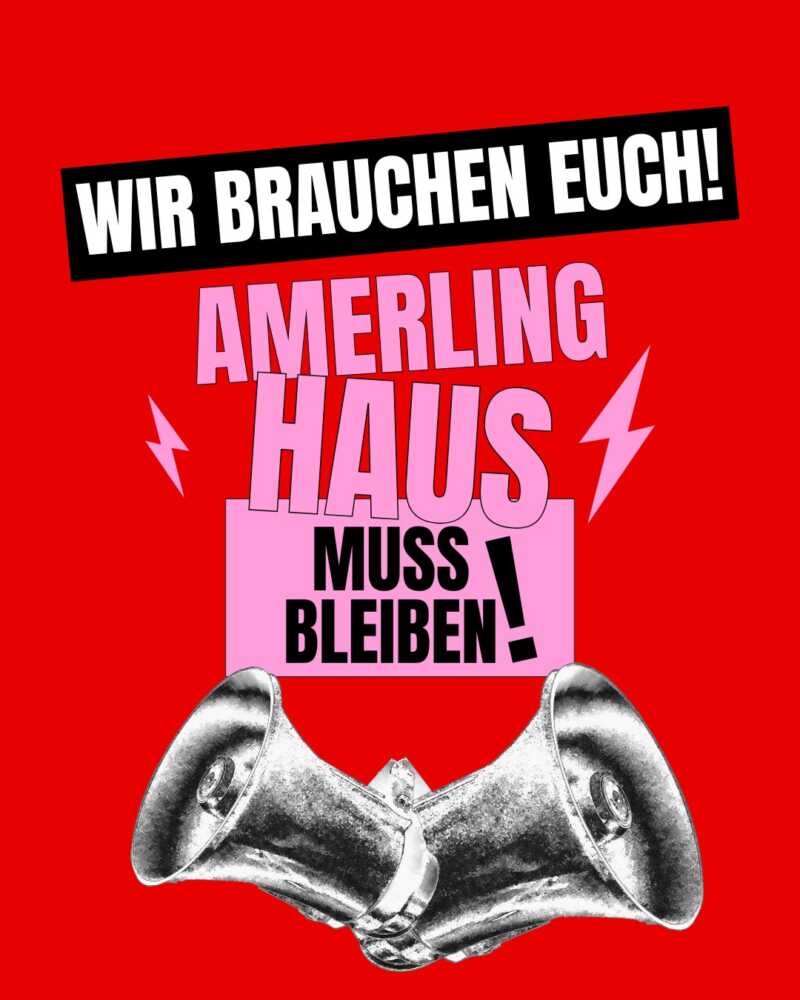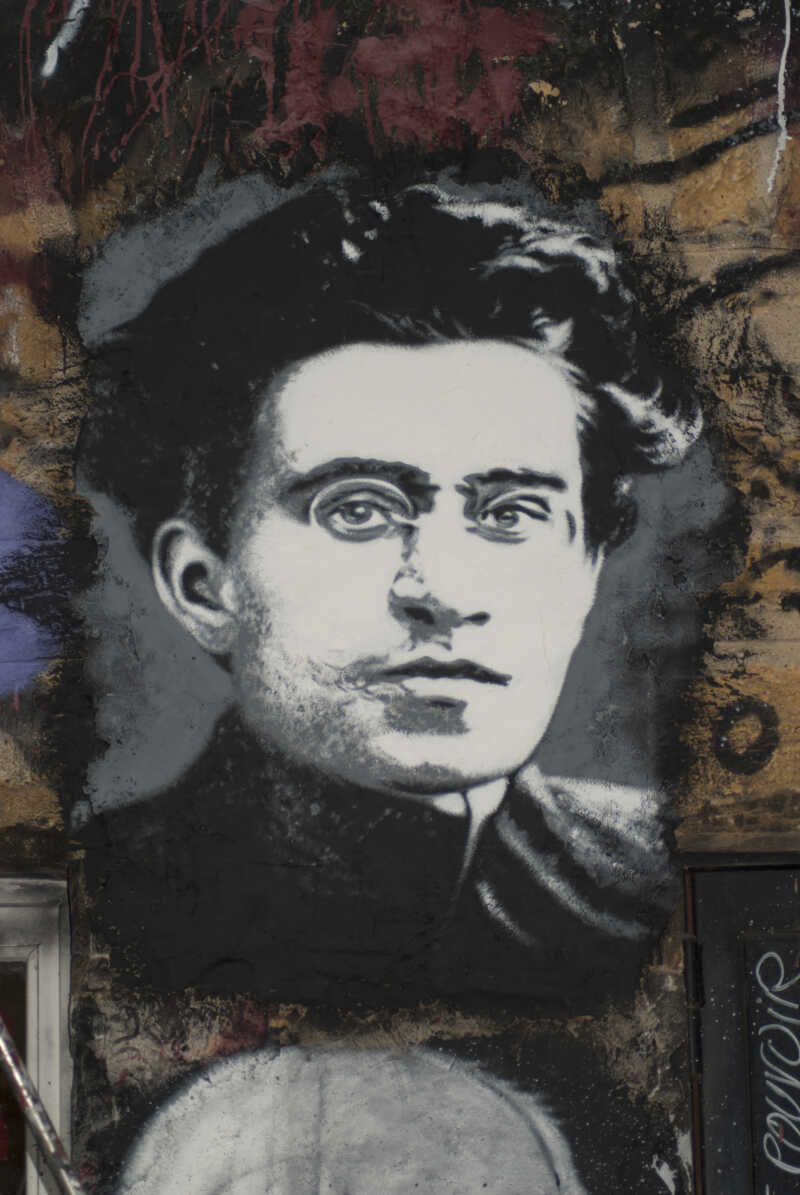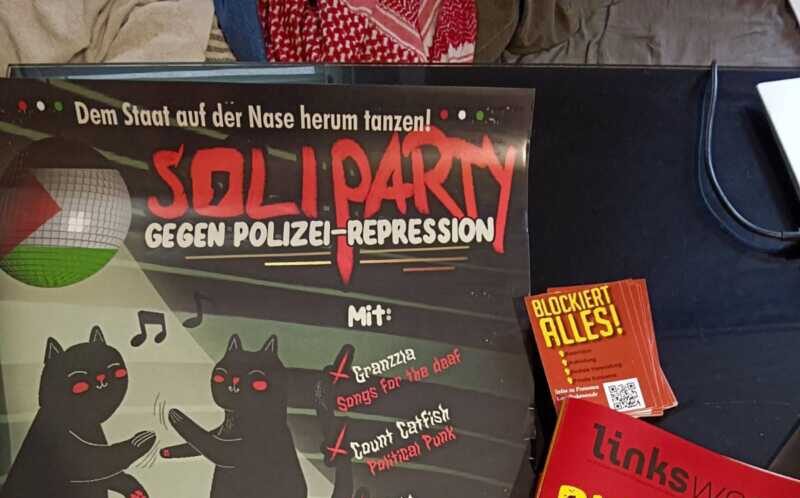Der „Westen“ ist bekanntlich untrennbar verbunden mit einer brutalen Geschichte des Kolonialismus, Imperialismus, ökonomischer Ausbeutung, ökologischer Verwüstung, und des Genozids. Genauso Teil dessen Geschichte ist jedoch auch ein verheerendes globales Finanzsystem, an dessen Früchten sich kapitalistische Zentrumsstaaten laben, während es Länder des globalen Südens dazu verdammt, an ihren Schuldenbergen förmlich zu ersticken. Die Geld- und Währungspolitik des „Westens“ stellt sich historisch als das Knie auf der Kehle all jener Staaten dar, die gezwungen sind, sich seiner Hegemonie zu unterwerfen. Geldordnungen, Strukturanpassungsprogramme, und Internationale Finanzinstitutionen sind folglich genauso zentral für die Aufrechterhaltung westlicher Herrschaft wie die Gewehrläufe amerikanischer Soldaten.
Die bis heute spürbaren Folgen der jüngsten sogenannten „großen Krise“ des Kapitalismus, nämlich der globalen Finanzkrise ab 2007, verschränken sich zurzeit drastisch mit den immer extremer werdenden Auswirkungen der Klimakatastrophe. Gleichzeitig wird die Welt Zeugin des Völkermords an der Palästinensischen Bevölkerung durch Israel, unter aktiver Beteiligung der USA und deren westlichen Verbündeten.
Diese Krisen haben im Grunde eines gemeinsam: Sie entspringen allesamt, abstrakt gesprochen, dem polit-ökonomischen Gefüge, welches wir als „den Westen“ bezeichnen. Das Platzen der mit fiktivem Kapital gemästeten Immobilienblase 2007 hatte seinen Ursprung in den USA. Die Klimakatastrophe ist als Ausdruck einer seit der Industrialisierung um sich wütenden und gnadenlos die Natur vereinnahmenden kapitalistischen Produktionsweise mit Ursprung in Europa zu verstehen. Der durch Israel verübte Völkermord in Palästina kann klar in das Koordinatensystem US-imperialistischer Vorherrschaft im gesamten arabischen Raum eingeordnet werden, und Israel selbst offenbart sich als verlängerter Arm des US-Imperialismus.
Wer oder was ist der „Westen“?
Um jedoch zu verstehen, wer nun eigentlich der „Westen“ ist, müssen wir die Zeit etwas zurückdrehen. Während des Kalten Krieges wurde konsequent die Idee des fortschrittlichen (kapitalistischen) Westens in Abgrenzung zur Idee des rückständigen (kommunistischen) Ostens konstruiert. Diese banale Kategorisierung diente der propagandistischen Abwertung all dessen, was sich nicht der Hegemonie der kapitalistischen Produktionsweise unterordnen wollte. Die „Rote Angst“ (Red Scare) bezeichnete in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Phase einer abstrus anmutenden antikommunistischen Massenhysterie, die vor allem in den USA ihr Unwesen trieb, und die unter anderem auch zur Verfolgung all jener führte, die als Feinde des Westens beziehungsweise als „kommunistisch“ definiert wurden, allen voran große Teile der politischen Linken. Diese vermeintlich diskursive Trennung zwischen West und Ost materialisierte sich nicht selten in Form von durch die USA orchestrierten Militärputschen in Ländern des globalen Südens, die diszipliniert werden sollten. Die Installierung des Pinochet-Regimes in Chile im Jahr 1973 ist hierbei wohl das beste Beispiel.
Heutzutage ist vielfach die Rede vom „Globalen Norden“, in Abgrenzung zum „Globalen Süden“. Ob man jedoch nun vom „Westen“ oder vom „Globalen Norden“ spricht, gemeint ist damit in beiden Fällen ein hegemonialer Machtblock, der innerhalb der Strukturen des globalen Kapitalismus das Zentrum der Herrschaft bildet. Doch wie genau offenbart sich diese Herrschaft? Durch welche politischen und ökonomischen Prozesse wird sie vermittelt? Welche Institutionen- und Normengefüge entfalten ihre Wirkung für die Dominanz des „Westens“?
Nun könnte man sich dieser Fragen aus vielerlei Richtungen nähern, etwa über die Betrachtung von Handelsregimen, Güterketten, oder Geopolitik. Was jedoch bei der Analyse globaler Herrschaft und Hegemonie oftmals ausgeklammert wird, ist die Rolle internationaler (Finanz-)Organisationen, und wie diese in Kooperation mit politischen Eliten, Bank- und Kreditinstituten, sowie wissenschaftlichen Einrichtungen, über die Beeinflussung ökonomischer Maßnahmen-Richtlinien global einerseits die faktische Herrschaft der kapitalistischen Zentren absichern und ausweiten, und andererseits den Neoliberalismus als nach wie vor dominantes wirtschaftspolitisches Paradigma heraufbeschwören und festigen.
Geld als Grundstein des Finanzsystems
Um diese Prozesse zu verstehen, widmen wir uns in einem ersten Schritt der historischen Analyse sogenannter „Geldordnungen“. Eine Geldordnung umfasst im Wesentlichen die in bestimmten historischen Perioden geltenden institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen auf internationaler Ebene Geldpolitik, Kreditvergabe, die Regelung von Wechselkursen, die Ausgestaltung des Finanzsystems, und vor allem die Währungspolitik gehandhabt werden. Die konkrete Ausformung einer spezifischen Geldordnung birgt erhebliche Folgen für Staaten, die mit ihren nationalen Geld- und Währungspolitiken zueinander in Konkurrenz stehen. Historisch haben sich auf der internationalen Ebene in bestimmten zeitlichen Abschnitten unterschiedliche Geldordnungen herausgebildet. An der Spitze der jeweils historisch spezifischen Geldordnung steht in der Regel der hegemoniale Staat, der im Moment die globale Ökonomie dominiert. Dessen nationale Währung nimmt folglich eine Sonderstellung ein, und ihm ist es beispielsweise möglich, sich in seiner eigenen Währung im Ausland zu verschulden, oder in eigener Währung seine Importe zu bezahlen, wodurch Wechselkursrisiken umgangen werden können. Im 19. Jahrhundert stieg England zur globalen Hegemonialmacht auf, wodurch fortan das britische Pfund zur dominanten Währung im globalen Maßstab aufstieg. Die britische Herrschaft über das Geld- und Währungssystem wurde schließlich durch die Etablierung einer bestimmten Geldordnung, nämlich dem sogenannten Goldstandard, abgesichert. Dieser umfasste die Bindung nationaler Währungen an ein bestimmtes Austauschverhältnis zu Gold, was für relativ stabile Wechselkurse sorgte. Dies ermöglichte es der britischen Ökonomie, internationalen Handel, Kreditvergabe, sowie Direktinvestitionen ohne hohe Wechselkursrisiken zu betreiben, und somit seine hegemoniale Position innerhalb der Weltökonomie zu festigen. Als mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ein relativer Niedergang der ökonomischen Bedeutung Englands einherging, kam es weitestgehend zur Auflösung des Goldstandards. Fortan etablierten sich die USA als die ökonomische Hegemonialmacht, was wenige Jahrzehnte später auch in der Herausbildung einer neuen internationalen Geldordnung münden sollte, die bis heute noch Nachwirkungen zeigt.
Schicksalhafter Tag in Bretton Woods
Am ersten Juli 1944 kamen die Finanzminister aus 44 Ländern der späteren Siegermächte in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat New Hampshire nahe Washington D.C. zusammen: „Bretton Woods“. Hier wurde daran gearbeitet, eine Nachkriegsgeldordnung zu schaffen, die das Rückgrat einer neuen, liberalen Weltwirtschaftsordnung bilden sollte. Hintergrund der Etablierung dieser neuen Geldordnung, des sogenannten Bretton-Woods-Systems (BWS), war vordergründig die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und die damit verbundene Instabilität des globalen Finanzmarktes. Gleichzeitig fand zu dieser Zeit ein fundamentaler Wandel der dominanten Akkumulationsmuster statt, hin zu stärker binnenorientierter und produktiver Akkumulation. Somit wurde auf der Bretton-Woods-Konferenz großer Wert darauf gelegt, ein System zu etablieren, das binnenstaatliche, industrielle Kapitalakkumulation fördern könnte. Folglich einigte man sich darauf, die freie Umtauschbarkeit von Währungen abzuschaffen, und damit de facto auch den unregulierten internationalen Kapitalverkehr. Zusätzlich kam es erneut zur Herausbildung fixer Wechselkurse, die jedoch politisch veränderbar waren, was zu einer hohen Flexibilität nationaler Geldpolitiken führte. Binnengerichtet kam es in vielen Staaten außerdem zu einer starken Regulierung des Finanzsektors, um Investitionen gezielt in produktive Sektoren der Ökonomie zu lenken. Nationale Zinspolitik und Kreditvergabeverfahren wurden zunehmend darauf ausgerichtet, langfristige Investitionen, etwa in Infrastruktur, zu finanzieren. Der US-Dollar, der nach wie vor eine Goldbindung hatte, galt dabei im Bretton-Woods-System als sogenannte Anker- oder Reservewährung, wodurch die USA eine gewisse Sonderstellung innerhalb des Finanzsystems einnahmen. Im Welthandel wurde für den Zahlungsverkehr folglich vorwiegend der US-Dollar genutzt, was die hegemoniale Position der USA im Welthandel widerspiegelt.
Als die zwei institutionellen Stützpfeiler der neuen Geldordnung und damit des überarbeiteten und stark regulierten internationalen Finanzsystems wurden schließlich einerseits die Weltbank, und andererseits der Internationale Währungsfonds (IWF) ins Leben gerufen. Im Gründungsvertrag des IWF wurde verfassungsartig diese neue Geldordnung verbindlich für alle unterzeichnenden Staaten festgelegt. Diese beiden Institutionen bestimmen bis heute große Bereiche der internationalen Währungspolitik, und sind nach wie vor zentrale globale Kreditinstitutionen, vor allem für Länder aus dem globalen Süden. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass die Agenda sowohl der Weltbank als auch des IWF, damals wie heute, maßgeblich von Policy-Eliten und Interessen aus den USA bestimmt ist. Schließlich verfügen die USA in den Gremien der beiden Institutionen über Stimmenanteile von 15,45% (Weltbank, 2023) beziehungsweise 16,50% (IWF, 2023), wobei für eine Sperrminorität mehr als 15% benötigt werden. Das bedeutet, dass in den beiden Organisationen de facto keine Entscheidung ohne die Zustimmung der USA getroffen werden kann. Die Stimmenanteile werden danach vergeben, wer die Institutionen am stärksten finanziert.
Freihandel ist unfair
Neben der Reorganisierung der internationalen Geldordnung durch das BWS kam es gleichzeitig auch zu einem massiven Abbau von Handelsbarrieren, was sich 1947 in der Etablierung des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) äußerte. Das GATT diente als das völkerrechtliche Rahmenwerk internationalen Freihandels, mit all seinen vernichtenden Folgen für Ökonomien des globalen Südens. Nach außen hin sollte also Freihandel ausgeweitet werden, was unter anderem den radikalen Abbau von Handelszöllen bedeutete. Gleichzeitig wurde im Rahmen des BWS versucht, Risiken spekulativer Finanz- und Währungspolitik einzudämmen, um vor allem in den Zentrumsstaaten des Kapitalismus eine stabile Finanzierungsgrundlage für die Ausweitung der Produktion zu gewährleisten. Von diesem System profitierten schließlich vorwiegend eben jene Zentrumsstaaten, denen es möglich war, die Früchte der gesteigerten nationalen Produktion auch am Weltmarkt abzusetzen, und somit positive Außenhandelsbilanzen zu erzielen.
Um dies zu ermöglichen, brauchten die kapitalistischen Zentren jedoch einerseits Länder, die sie für billige Rohstoffe ausbeuten konnten, und die andererseits als Absatzmärkte für hochpreisige Industrieprodukte herhalten konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte jedoch in Parallele zur Herausbildung des BWS eine Phase mehr oder minder rascher Dekolonisierungsprozesse. Viele Länder erlangten ihre formale Unabhängigkeit von ihren ehemaligen Kolonialmächten, und verfolgten nach der Etablierung neuer Nationalstaaten vielfach das Ziel, nationale ökonomische Entwicklungsprogramme voranzutreiben, und damit weitreichende Industrialisierungsprozesse und Wirtschaftswachstum in Gang zu setzen. Vor allem in Lateinamerika war die Strategie der „Import-substituierenden Industrialisierung“ (ISI) weit verbreitet, eine Wirtschaftsstrategie, welche im Wesentlichen von dem Argentinier Raúl Prebisch und dem Brasilianer Celso Furtado theoretisiert wurde. Ihnen zufolge würde der Freihandel die Länder des globalen Südens, allen voran ehemalige Kolonien, dazu verdammen, für die Zentrumsstaaten als billiger Lieferant von Rohstoffen zu fungieren. Dies würde dazu führen, dass die Produktionskapazitäten und Finanzmittel nicht für die Entwicklung der heimischen Industrie zur Verfügung stehen, sondern lediglich für die Servicierung des Ressourcenhungers der Zentrumsstaaten. Durch die ISI kam es in Ländern des globalen Südens vielfach zu Verstaatlichungen wichtiger industrieller Sektoren, zentralisierter ökonomischer Planung, und der Errichtung von Außenhandelsbarrieren. Dies darf jedoch keineswegs als antikapitalistische Wirtschaftspolitik missverstanden werden. Die Entwicklung der nationalen Industrien im Rahmen der ISI-Strategie diente schlussendlich dem Zweck, selbst am kapitalistischen Weltmarkt wettbewerbsfähig zu werden.
Ende der westlichen Toleranz
Anfänglich wurden diese nationalen Entwicklungsprojekte von westlichen Staaten weitestgehend toleriert, so auch von den USA. Über die Weltbank wurden in den 1950er Jahren in Lateinamerika, ein wichtiger Absatzmarkt für amerikanische Industrieprodukte, zahlreiche Kredite vergeben, um vor allem den Ausbau ökonomisch relevanter Infrastruktur zu finanzieren. Die eingängliche Toleranz der protektionistischen Maßnahmen im Rahmen der ISI-Strategie, sowie die Finanzierung nationaler Entwicklungsprogramme in Lateinamerika, rührte jedoch keineswegs von einem Wohlwollen gegenüber Staatsinterventionismus und eingeschränktem Freihandel her. Vielmehr ging es darum, Länder des globalen Südens in Zeiten des Kalten Krieges über die Unterstützung nationaler Entwicklungsprogramme ökonomisch wie ideologisch an den Westen zu binden, um sie nicht an den „Ostblock“ zu verlieren.
Bald schon sollte sich der Umgang des Westens mit diesen Ländern und deren ökonomischen Nationalismen jedoch tiefgreifend ändern. Ab den 1960er-Jahren offenbarten sich die Schwachstellen des Bretton-Woods-Systems. Im Zuge des Vietnamkrieges kam es zu einer starken Inflation des US-Dollars, der ohnehin bereits als stark überbewertet galt. Zudem wurden Zweifel daran breit, ob die Dollar-Reserven auch ausreichend durch physische Goldreserven gedeckt waren. Als im Jahr 1971 der damalige US-Präsident Richard Nixon die Goldbindung des Dollars endgültig aufhob, kündigte er damit auch gleichzeitig die bestehende Geldordnung des Bretton-Woods-Systems auf. Mit der Aufhebung der Wechselkursfixierung zwei Jahre später war ihr Ende schließlich besiegelt.
Geburtsstunde des Neoliberalismus
Die 1970er Jahre waren in Folge des Zusammenbruchs des BWS eine Zeit der hohen ökonomischen Volatilität. Die Ölschockkrise 1973, sinkende Wachstumsraten, sowie hohe Inflationsraten, veranlassten Länder des globalen Südens dazu, sich bei westlichen Industriestaaten noch höher zu verschulden, als sie es ohnehin schon waren. Als 1979 die amerikanische Nationalbank die Zinsraten auf Kreditrückzahlungen aus vor allem lateinamerikanischen Ländern erhöhte, um Kapitalflüsse in die USA zu erhöhen, wurden viele Länder Lateinamerikas in Anbetracht des enormen Schuldenberges zahlungsunfähig. Daraus folgte eine massive Einbuße von Verhandlungsmacht jener Staaten. Auch andere Zentrumsstaaten fühlten sich gezwungen, die Zinsen auf ausländische Kapitalflüsse zu erhöhen. Es kam schließlich zu einer massiven Aufwertung des US-Dollars und zu einem Abbau von Beschränkungen auf internationalen Kapitalverkehr. Die daraus entstehende Geldordnung wird fortan als „Dollar-Wall-Street-Regime“ bezeichnet, erneut mit den USA an der Spitze. Der Kapitalmarkt wurde infolgedessen stark liberalisiert und marktförmig ausgerichtet.
Nicht nur die Währungs- und Finanzmärkte wurden jedoch ab den 1970ern Liberalisierungsprozessen unterzogen. In vielen Zentrumsstaaten, allen voran den USA und Großbritannien, kamen Regierungen an die Macht, die als Geburtshelfer neoliberaler Wirtschaftspolitik fungieren sollten, allen voran Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Die Welt war bereit für eine allumfassende und völlige Entfesselung des neoliberalen Kapitalismus.
Dafür waren erneut die internationalen Finanzinstitutionen, die den Tod des Bretton-Woods-Systems unbeschadet überlebt hatten, von zentraler Bedeutung. Die Weltbank und der IMF, beide mit Sitz in Washington und vom US-Finanzministerium zu Fuß nur wenige Minuten entfernt, übernahmen in den 1980ern die Federführung in der Herausarbeitung eines wirtschaftspolitischen Maßnahmen-Pakets, das der Neoliberalisierung in globalem Maßstab Vorschub leisten sollte. Der Grundkonsens dieses Maßnahmen-Paketes, der in Folge auch als „Washington Consensus“ bezeichnet wurde, zielte darauf ab, praktisch in jedem Staat der Welt Freihandel, Privatisierung, und Deregulierung in allen Sektoren der Ökonomie voranzutreiben. Dieser Konsens entfachte im Kontext der lateinamerikanischen Schuldenkrise zuerst seine Wirkung. Der damalige US-Finanzminister James A. Baker III hatte die Idee, dass man verschuldete Länder in Lateinamerika mithilfe von Notkrediten dazu drängen sollte, marktliberalisierende Reformen durchzudrücken. Die Weltbank und der IWF folgten dieser Vorstellung und stimmten infolgedessen ihre Politiken der Kreditvergabe aufeinander ab. Was daraus entstand war die Entwicklung sogenannter „structural adjustment loans“ (Strukturanpassungsprogramme), also im Wesentlichen von Notkrediten, deren Vergabe an bestimmte Bedingungen gebunden waren. Um also solche Notkredite zu erlangen, auf die sie aufgrund der hohen Zinsen auf ihre Kreditrückzahlungen angewiesen waren, mussten die davon betroffenen Länder bestimmte Maßnahmen umsetzen. Diese umfassten beispielsweise die Abschaffung von Handelsbarrieren, den Abbau von Restriktionen auf ausländische Direktinvestitionen, die Beschränkung des Budgetdefizits, die Streichung von als überflüssig angesehenen Subventionen, die Flexibilisierung der Zinsraten, die Privatisierung staatlicher Industrien, sowie die umfassende Deregulierung ökonomischer Aktivitäten in allen Sektoren. Bald übernahmen auch regionale Finanzinstitutionen, so etwa die Afrikanischen Entwicklungsbanken, die von den IFIs vorgezeichneten Konditionalitäten für ihre Kreditvergabepolitiken. Auch bilaterale Geldgeber, allen voran die Europäische Union, verlangten, dass sich bei ihnen verschuldete Länder an die Vorgaben der IFIs zu halten haben.
Peitsche der Homogenität
Die Umsetzung der Kreditkonditionen und damit der Maßnahmen wurde schließlich auch aktiv forciert. Es ging sogar so weit, dass World Bank und IWF Mitarbeiter:innen in die jeweiligen Ministerien der betroffenen Staaten geschickt wurden, um dort die Umsetzung des Policy-Prozesses persönlich zu überwachen. Gleichzeitig standen während der Schuldenkrise an der Spitze lateinamerikanischer Regierungen vielfach Menschen aus dem IFI-Umfeld, allesamt mit Graduierten-Abschlüssen in Ökonomie von einflussreichen amerikanischen Universitäten. Das Studium vieler dieser Ökonom:innen wurde direkt von den IFIs finanziert. Es kam zur Herausbildung einer in den USA ausgebildeten bürokratischen Elite, die maßgeblich an der Umsetzung des Washington Consensus beteiligt waren. Folglich war es auch wichtig für dessen Erfolg, eine gewisse ideologische Homogenität herzustellen. In der akademischen ökonomischen Disziplin wurde der Triumph der neoklassischen Ökonomie als Leitbild für globale Entwicklung ausgerufen. Die Diffusion der IFI-Maßnahmen legitimierte sich durch die Ideen einer ökonomischen Denkweise, welche fortan beanspruchte, die unangefochtene Wahrheit über die Funktionsweise globaler ökonomischer Prozesse zu besitzen. Widerstand auf der Ebene der Ideenproduktion wurde rasch ausgemerzt. In manchen Fällen intervenierte die amerikanische Regierung sogar direkt in Bestellungspolitiken der Weltbank, um sicherzustellen, dass die Ideenproduktion innerhalb der IFIs konsistent bleibt mit dem Washington Consensus. Im Jahr 2000 etwa übte das US-Finanzministerium massiven Druck auf die Weltbank aus, um den Rücktritt von Joseph Stiglitz zu forcieren, nachdem er die Strategie des IWFs im Umgang mit der „Asian Financial Crisis“ heftig kritisiert hatte. Es lässt sich folglich also beobachten, dass die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der bürokratischen Herrschaft auch mit einer Herrschaft über die (ökonomischen) Ideen einhergegangen ist.
In den Ländern des globalen Südens hatten die Strukturanpassungsprogramme vielfach drastische Reallohnsenkungen, massive Kürzungen von Sozialausgaben, und die Aufhebung von staatlichen Subventionen auf Grundnahrungsmittel zur Folge, was in einem enormen Anstieg sozialer Verwerfungen mündete. Gleichzeitig kam es zu riesigen Kapitalabflüssen aus den Peripherien in Form von Kreditrückzahlungen, in die kapitalistischen Zentren, die damit ihre Kapitalakkumulation antreiben konnten. Seitdem kommt es in der Weltökonomie immer wieder zu sogenannten „Boom-Bust-Zyklen“, bei denen es erst in Form von Notkrediten zu Kapitalzuflüssen in Ländern des globalen Südens kommt, im Anschluss daran jedoch wieder zu enormen Kapitalabflüssen, wodurch sie immer wieder in ökonomische Krisen gestürzt werden. Besonders Europa und die USA, die als Hauptfinanziere dieses ausbeuterischen Kreditsystems fungieren, profitieren durch periodische massive Kapitalflüsse von diesen Prozessen. Gleichzeitig lässt sich feststellen, dass durch die Neoliberalisierung der peripheren Ökonomien diese weiterhin dazu verdammt sind, primär als Ressourcenlieferanten für die industriellen Zentrumsstaaten im Kapitalismus zu fungieren.
Epilog
Die Funktionsweise und damit die Herrschaft des „Westens“ wurde in diesem Artikel stark mit Fokus auf das Finanzsystem analysiert. Es ist jedoch klar, dass einem Staat die Durchsetzung und Aufrechterhaltung seiner hegemonialen Position innerhalb dieses Systems nur dann gelingen kann, wenn er seine ökonomische Vorherrschaft auch mittels roher militärischer Macht absichern kann. Selbst wenn neben den USA auch andere Zentrumsstaaten wie Frankreich, Deutschland oder Großbritannien regelmäßig ihre militärischen Mittel zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen einsetzen, später auch gemeinsam im NATO-Bündnis, kommt den USA als Welthegemon zurzeit immer noch eine Sonderstellung zu. Diese scheint sich im Moment jedoch im Umbruch zu befinden. Der derzeitige US-Präsident Donald Trump selbst unterstreicht die besondere Rolle des US-Militärs für die Aufrechterhaltung der westlichen Ordnung, indem er Staaten wie Deutschland und Japan vorwirft, von amerikanischen Märkten und militärischer Macht unfairerweise zu profitieren. „America First“ spiegelt den Anspruch Trumps wider, dass andere Zentrumsstaaten gefälligst ihr eigenes Gewicht tragen und sich nicht immer auf die USA verlassen sollen. Trumps Forderungen gegenüber westlichen NATO-Bündnisstaaten, ihre eigenen Rüstungsausgaben drastisch zu erhöhen, bei gleichzeitiger massiver Aufstockung des US-Militärbudgets, zeugt von einer zunehmenden Polarisierung der westlich-liberalen kapitalistischen Ordnung. Trumps „Make America Great Again“ Strategie stellt sich folglich als ein verzweifelter Versuch dar, die US-Hegemonie über die internationale Wirtschaftspolitik, auch vor dem Hintergrund eines erstarkenden Chinas, aufrecht zu erhalten. Der zurzeit stattfindende Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union ist folglich als Ausdruck eines Kampfes um die hegemoniale Vormachtstellung innerhalb der globalen Ökonomie zu verstehen. Die geopolitischen und geoökonomischen Rahmenbedingungen des globalen Wirtschaftssystems befinden sich somit im Moment in einer enorm zugespitzten Lage. Die Aufrechterhaltung und Stabilisierung westlicher Vorherrschaft und damit des Kapitalismus bleibt vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse schließlich ein offener Prozess. Gleichzeitig bleibt es ein hegemoniales Projekt, das es weiterhin mit vollster politischer Kraft zu bekämpfen gilt.