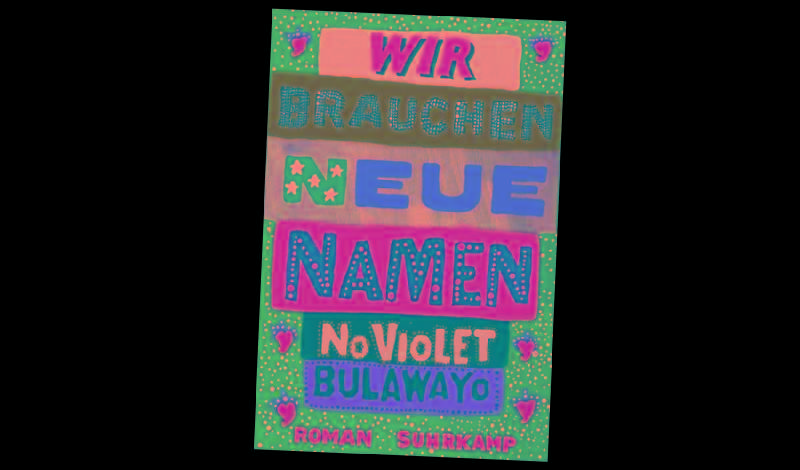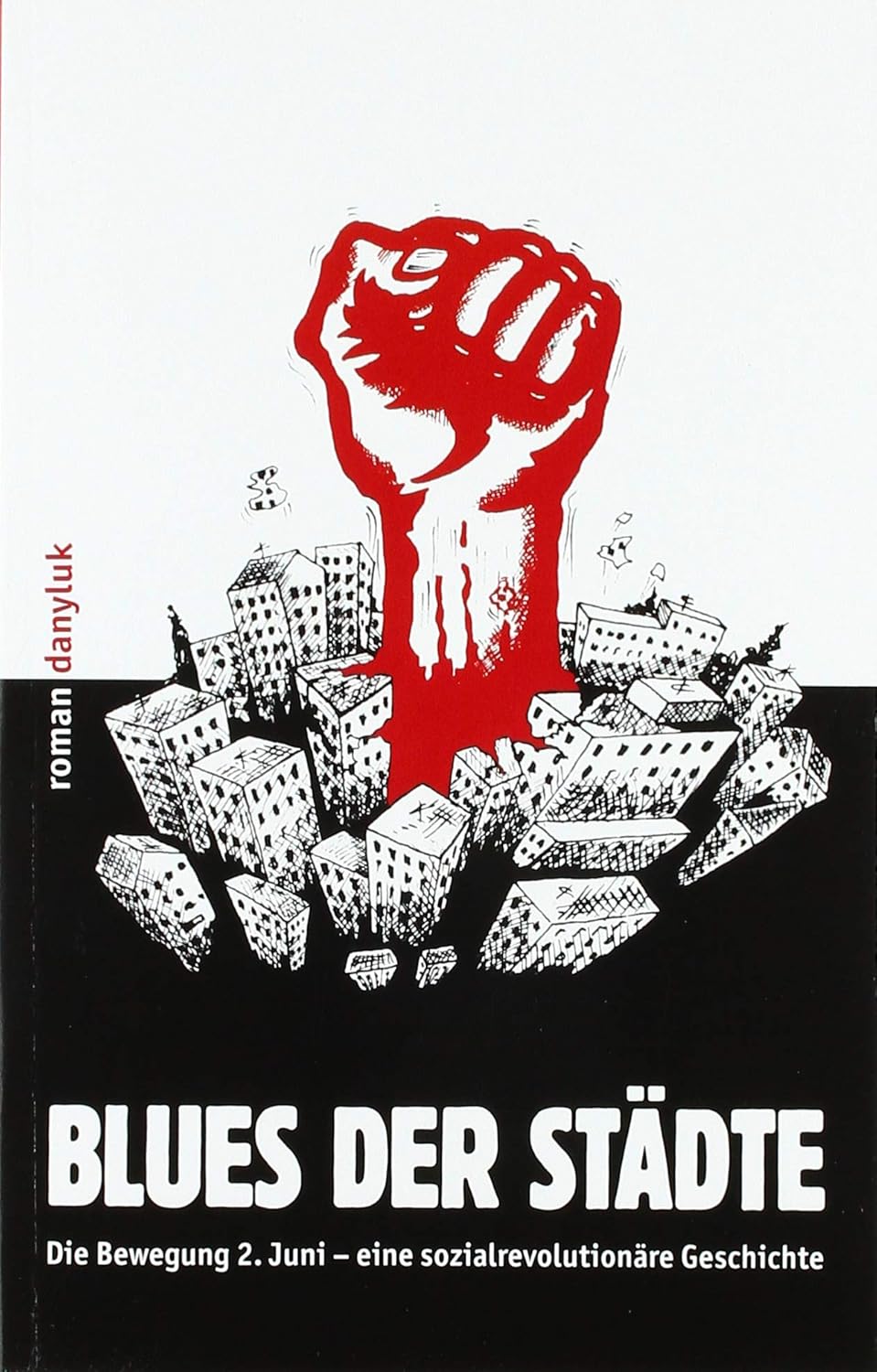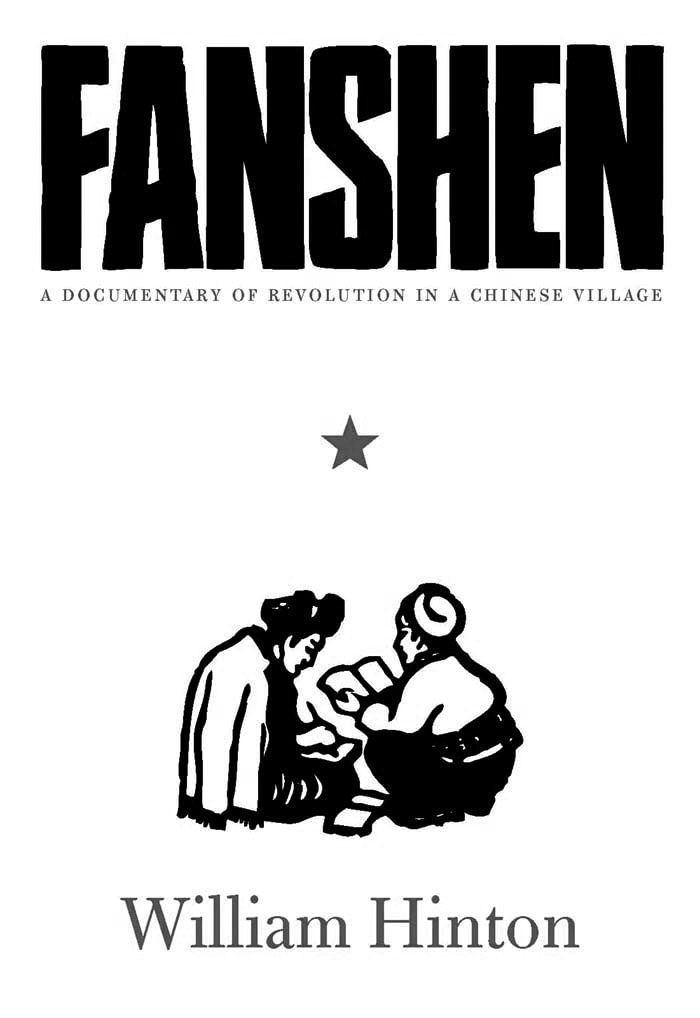Linker Lesetipp. Suhrkamp, 264 Seiten, ISBN 978-3-518-42451-3, 22,60€
Wir brauchen neue Namen erzählt die Geschichte der 10-jährigen Darling, die mit ihren Freunden Bornfree und Nomoreproblems in der von Mugabe herabgewirtschafteten Barackensiedlung Paradise in Simbabwe lebt. Bei aller Armut sind sie vor allem ganz normale Kinder: frech, blitzgescheit und vor allem mit Spielen beschäftigt. Spiele wie „Bin Laden finden“ (dafür ist angeblich eine große Belohnung ausgesetzt) oder das „Länderspiel“ bei dem jeder gern die USA sein möchte „der Obermacker auf der Welt“. Das Getue der Erwachsenen finden sie „kaka“ und alle träumen sie von einer Zukunft im reichen Norden.
NoViolet Bulawayo, selbst in Simbabwe aufgewachsen ist, romantisiert weder das Elend, noch lässt sie zu, dass sich ihre Leser_innen daran aufgeilen. Stattdessen hält sie den Spiegel denen vor, die sich als Retter produzieren: „Jetzt singen und schreien wir, als wären wir echt durchgedreht … und warten darauf, dass die NGOs rauskommen … Wenn wir uns ins Zeug legen, sind sie nämlich beeindruckt und schenken uns vielleicht noch was und dann noch was und dann noch was, bis wir sagen, Bitte, NGOs, erschlagt uns nicht mit euren Geschenken! … Die machen einfach gern Fotos, diese NGO-Leute, wie echte Freunde und Verwandte irgendwie … Es schert sie nicht, dass der Dreck und die zerfetzten Kleider uns peinlich sind, dass es uns lieber wäre, wen sie das sein lassen, sie knipsen trotzdem, knips knips knips. Wir meckern nicht, weil wir wissen, dass nach dem Knipsen die Geschenke dran sind.“
In der zweiten Hälfte ist Darling zu ihrer Tante nach „Destroyed-michigen“ (Detroit/Michigan) ausgewandert („Wie schwierig es war, nach Amerika zu kommen schwieriger, als durch den Anus einer Nadel zu kriechen.“), doch das Leben in den USA ist ganz anders, als in ihrer Vorstellung. Dass draußen eine Kälte herrscht, die „dich aufschneiden und dir die Knochen abfackeln“ will oder dass sie in der Nacht Schüsse hört, verheimlicht sie in ihren Briefen nach Simbabwe. Sie fühlt sich schuldig, dass sie ihre Familie und Freunde zurückgelassen hat und vermisst ihr altes Leben, das ihr immer unwirklicher erscheint: „Zu Hause würde ich ganz bestimmt nicht rumstehen, weil ein sogenannter Schnee mich davon abhält, nach draußen zu gehen und mein Leben zu leben.“ Doch zurück kann sie nicht einmal auf Besuch, denn dann wäre eine neue erneute Einreise unmöglich.
Bulawayo erzählt vom Leben der „Illegalen“, ohne sich jemals in Klischees oder Sentimentalität zu verlieren: Darling fürchtet sich, als Schwarze von der Polizei erschossen zu werden, aber sie verliert sich mit ihren Freundinnen auch mit einer Mischung aus Ekel und Faszination in Internet-Pornos. Doch wirklich anzukommen in Amerika ist ihnen nicht erlaubt: „Wir saßen angespannt auf einer Pobacke, denn wie kann man auf beiden sitzen, wenn man sein Morgen nicht kennt?“