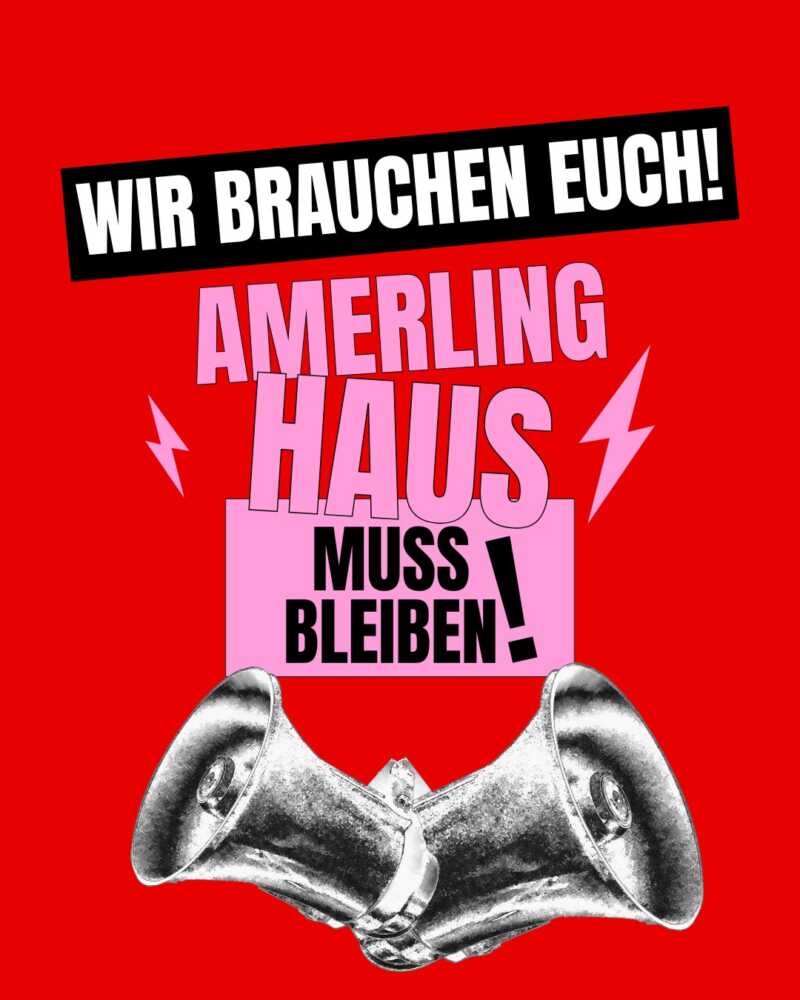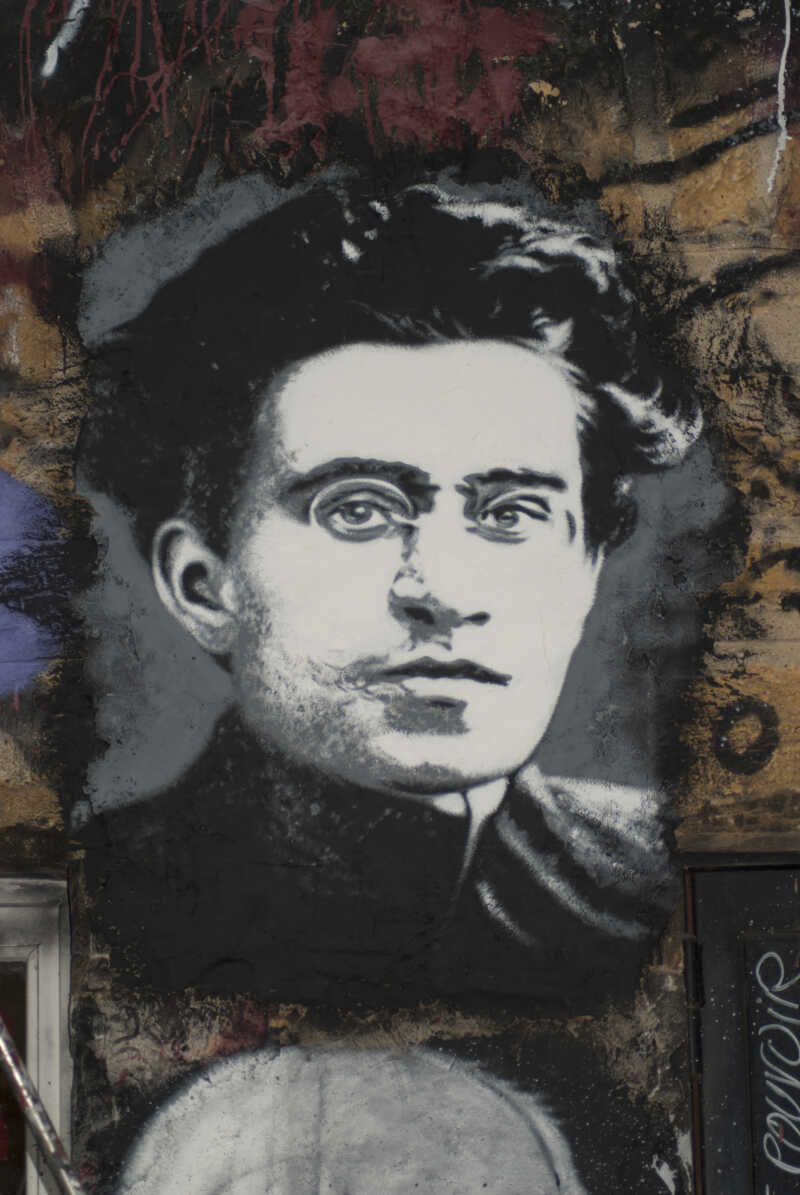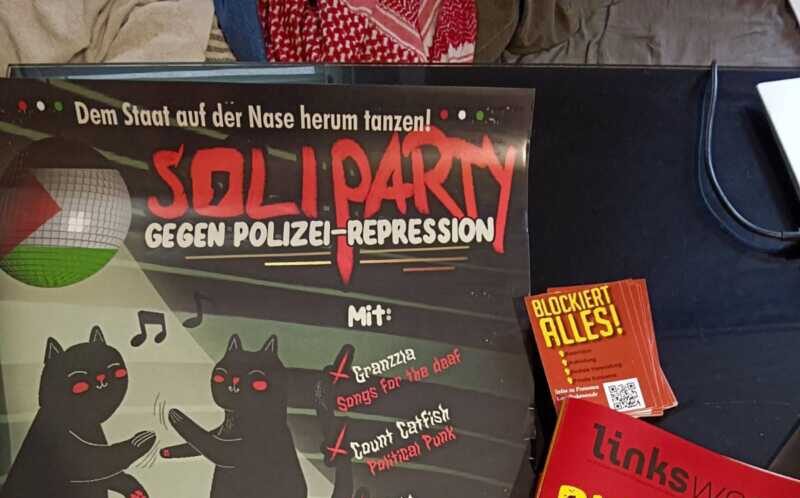Von 1945 bis 1986 war die FPÖ eine Kleinpartei für Nazis und Ultraliberale mit einer konstanten Anhängerschaft im bürgerlichen Milieu. Ab Mitte der 80er-Jahre begann der kometenhafte Aufstieg der FPÖ. Stück für Stück gelang es ihr auch innerhalb der Arbeiter:innenklasse Fuß zu fassen. 2024 gewann sie zum ersten Mal eine Nationalratswahl. Unter den Arbeiter:innen ist sie die stärkste Kraft. Selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern verzeichnet die FPÖ eine stabile Anhänger:innenschaft. Aber, wie stark ist die FPÖ wirklich unter Arbeiter:innen? Wie ist ihr Aufstieg innerhalb der Arbeiter:innenklasse zu erklären, und was bedeutet dieser Prozess für Sozialist:innen?
Wahlanalysen folgen der juristischen Unterscheidung zwischen Arbeiter:innen und Angestellten. Hier werden jene, die primär körperlich arbeiten, als Arbeiter:innen eingeordnet, jene, die anderen Tätigkeiten nachgehen als Angestellte. Der Marxismus erklärt alle jene zur Arbeiter:innenklasse, welche einer Lohnarbeit nachgehen müssen, um zu überleben. Für Marxist:innen fallen damit viele Angestellte in die Arbeiter:innenklasse, bspw. Buchhalter:innen oder Verkäufer:innen, jedoch nicht Manager oder reiche Erben.
Die marxistische gefasste Arbeiter:innenklasse ist damit deutlich größer als die soziologisch gefasste. Historisch gesehen waren jedoch insbesondere die körperlich-industriellen Arbeitenden das Herzstück der Arbeiter:innenbewegung. Dies lag daran, dass sie oft in riesigen Unternehmen mit zehntausenden Kolleg:innen arbeiteten. Darum, weil die soziologisch/juristische Definition der Arbeiter:innen dem historischen Kernsegment der Arbeiter:innenbewegung relativ nahe kommt, ist sie für Marxist:innen relevant. Wenn ausgerechnet jene Gruppe, die vor 50 Jahren die Basis unserer Bewegung stellte, heute rechtsextrem wählen, ist das ein Problem. Es funktioniert auch nicht mehr. 2024 gewann die FPÖ unter Arbeiter:innen mit gigantischem Vorsprung und Angestellten mit deutlichem. Ein relevanter und fast immer ignorierter Faktor in Wahlanalysen ist, dass ein großer Teil der Arbeiter:innenklasse von den Wahlen ausgeschlossen ist oder sich nicht beteiligt.
Auschluss der Armen
Insbesondere der ökonomisch schlechter gestellte Teil der Arbeiter:innenklasse tendiert zum Nicht-Wählen. 2019 gingen 83 % des ökonomisch am besten gestellten Drittels wählen, wohingegen sich nur 59 % des unteren Drittels an der Wahl beteiligten. Gleichzeitig stimmen 74 % dieses untersten Drittels der Aussage „Die Politik behandelt Menschen wie mich als Menschen zweiter Klasse“ zu. Dass arme und ungebildetere Menschen nicht wählen gehen, ist kein Naturgesetz, sondern eine neuere Entwicklung. Anfang der 70er-Jahre war bspw. die Wahlbeteiligung in den Wiener Arbeiter:innenbezirken deutlich höher als in den bürgerlichen. Dieses Verhältnis ist heute genau umgekehrt.
Verstärkt wird dieser Ausschluss der Arbeiter:innenklasse nochmals dadurch, dass die Staatsbürgerschaft an das Wahlrecht geknüpft ist. In Österreich arbeiten 700.000 Menschen, die von der Wahl ausgeschlossen sind. Beispielsweise darf unter den Hilfsarbeiter:innen weniger als die Hälfte wählen.
Die Niederlage der Linken
Der Aufstieg der extremen Rechten begann mit der Niederlage der Arbeiter:innenbewegung in den 70er-Jahren. Die sozialdemokratischen Parteien konnten dem beginnenden Neoliberalismus nichts entgegensetzen bzw. wurden selbst zu Vertretern neoliberaler Politik. Der Neoliberalismus besiegte die Arbeiter:innenbewegung nicht nur politisch, sondern führte zu einer teilweisen Umstrukturierung der Wirtschaft. Finanzmärkte wurden wichtiger, staatlicher Besitz weniger, Industriearbeitsplätze gingen zurück, die Wirtschaft wurde auf globale Lieferketten umgestellt. Aus dieser Niederlage folgte eine ideologische wie organisatorische Schwächung der Institutionen der Arbeiter:innenbewegung.
In Österreich ist die neoliberale Wende nicht so eindeutig zu datieren wie in England oder Frankreich. Während Thatcher die englische Arbeiter:innenbewegung frontal angriff, regierte in Österreich Kreisky. (1970-1983) Kreisky setzte auf eine Wirtschaftspolitik von starken Staatseingriffen, hohen Schulden und geringer Arbeitslosigkeit. Dank der Zuliefererrolle Österreichs für Deutschland konnte der Austrokeynesianismus für die Industriearbeiter:innen funktionieren. Gastarbeiter:innen wurden auch damals aus der Arbeiter:innenbewegung ausgeschlossen. 1981 hatte der ÖGB 1,6 Millionen, 2023 1,2 Millionen Mitglieder, obwohl die Zahl der Lohnabhängigen gestiegen ist. Die SPÖ hatte 1979 ihren Höchststand von 720.000 Mitgliedern, 2023 nur mehr 147.000, mit einem Durchschnittsalter von 63 Jahren.
Zu Kreiskys Zeiten war die FPÖ eine Altnazi-Partei mit liberalem Anstrich, die kaum über 5 Prozent hinauskam. Eine nennenswerte Wählerschaft innerhalb der Arbeiter:innenklasse hatte sie nicht. Kreisky nützte diese Schwäche und bot ihr an, ihr zum ersten Mal demokratische Respektabilität zu verleihen, wenn die FPÖ seine Minderheitsregierung stützen würde. So verräterisch dieser Schritt aus antifaschistischer Perspektive ist, so zielte diese Politik noch auf eine Stärkung der Arbeiter:innenbewegung. Ganz anders als die blau-schwarzen Bundesregierungen oder die rot-blauen Koalitionen in Kärnten 2004 und 2015 im Burgenland.
Der braune Marsch beginnt
1986 kratzte die FPÖ zum ersten Mal an der 10-Prozent-Hürde, 1990 erhielt sie bereits 16 % der Stimmen. Die SPÖ hatte 1986 die absolute schon verloren, lag jedoch noch bei 43 %. Aber der Abwärtstrend ließ sich nichtmehr umkehren. Im Unterschied zur ÖVP, die 2002 und 2019 fast die Stärke von vor 86 erreichte.
Interessant sind die Nationalratswahlen 1994, der FPÖ gelang es zum ersten Mal in die Arbeiter:innenklasse (ohne Angestellte) einzudringen und erreicht 29 %, die SPÖ immer noch 47 %. Gegenüber 1986 hatte sich die FPÖ in der Arbeiterschaft verdreifacht, dieser Trend setzte sich fort. Was war in dieser Schlüsselphase Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre passiert. Alles einzig und allein auf die Figur Haider zu schieben, ist schlicht falsch.
Unter Vranitzky ging die Phase des „Kreisky-Sozialismus“ zu Ende. Der Staat zog sich aus der Wirtschaft zurück, insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit stieg, die Industriearbeit ging weiter zurück. Gleichzeitig führte die beginnende Öffnung zum osteuropäischen Markt zu einem verstärkten Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmer.
Der EU-Beitritt 1995 manifestierte die neoliberale und internationale Ausrichtung der österreichischen Wirtschaft. Vier Jahre nach dem Beitritt kletterte die FPÖ auf 26 %. Ganz wie heute waren neben Rassismus, Anti-Korruption und Anti-EU/Globalisierung treibende FPÖ-Wahlmotive. An die 50 % der wählenden Arbeiter wählten FPÖ. Nach dem Scheitern der ersten schwarz-blauen Regierung brach dieser Anteil auf 15 % ein. Im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen noch immer leicht überproportional.
Vergleicht man die FPÖ-Abstürze, springt ins Auge, der Absturz nach dem Ibiza-Skandal war schwächer und kürzer. Die Arbeiter:innen hielten der FPÖ stärker die Treue als andere Gruppen. Insofern steigt nicht nur die FPÖ-Wähler:innenschaft, sondern auch die Bindung von Teilen der Wähler:innen an die Partei. Wer fünfmal aus Protest blau wählt, muss beim fünften Mal überzeugter sein als beim ersten Mal.
Ökonomische Erklärungen
Analytisch interessant ist eine aktuelle Arbeitsmarkt-ökonomische Studie von Karim Bekhtiar. Auf Basis von umfassendem Datenmaterial zeigt er für die Phase 1995-2019, dass die Abnahme der Industriearbeit neben Migration der zentrale Erklärungsfaktor für den Aufstieg der extremen Rechten ist.
Nicht spezifisch für Österreich gibt es eine umfassende Materialsammlung der soziologisch-ökonomischen Erklärung des Aufstiegs der extremen Rechten. Von steigender Arbeitslosigkeit, über sinkende Lohnquoten und Austeritätsmaßnahmen lässt sich nicht leugnen, dass der faschistische Siegeszug ein Bastard der neoliberalen Wirtschaftspolitik ist. Der springende Punkt an diesen Studien ist, dass eher die Angst vor dem Abstieg, nicht der Abstieg selbst, die Menschen zum rechts wählen motiviert. Menschen, die ökonomisch schnell und hart absteigen, tendieren eher zu Resignation und Nicht-Wählen. Die Menschen, die in ihrem Umfeld jedoch Arbeitslosigkeit mitbekommen, darum davor Angst haben, sind jene, die zu radikalen Schlüssen neigen. Dass sich die Wut über Ungerechtigkeit gegen Ausländer nicht Bosse entzündet, zeigt, wie erfolgreich die rassistische Propaganda der herrschenden Klasse ist.
Paulus Wagner führte für seine Doktorarbeit 120 Interviews mit Arbeiter:innen in Österreich und Ostdeutschland durch. Er argumentiert, dass Fustration über autoritäre Arbeitsstrukturen ein idealer Nährboden für „Sozialchauvinismus” ist. „Diejenigen, die am Arbeitsplatz Missachtung, Misstrauen, Willkür, anhaltende Konflikte zwischen Führungskräften und Mitarbeitern erleben, nehmen ein Gefühl der Entfremdung – die Gesellschaft ist kein gerechter Ort – mit nach Hause. Bei den, die solche Bedingungen über längere Zeiträume hinweg erleben, gibt es ein wiederkehrendes Muster von Verhaltensreaktionen”: Sie tendieren zu einer extrem emotionalisierten Unterscheidung zwischen sich selbst als hart arbeitend, und jene, die nicht arbeiten und Dinge umsonst vom Staat erhalten. In dieses Gefühl des eigenen Ausschlusses aus dem wichtigsten Lebensbereich – der Arbeit – können die rechtsextremen Parteien hineinstoßen. Sie verstärken die Schuldumkehr weg von den Arbeitsbedingungen hin zu dem Fremden, und vermitteln gleichzeitig den Stolz auf das eigene Schaffen. In der Studie „Die Ethnisierung von Verteilungsfragen durch die Freiheitliche Partei Österreichs” wird ähnlich argumentiert. Die FPÖ arbeitet daran, den horizontalen Verteilungskonflikt Arbeiter:innenklasse gegen Kapital durch einen vertikalen, österreichische gegen ausländische Arbeiter:innenklasse, zu ersetzen. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass 13 % der Befragten diesem Sozialchauvinismus zustimmen und breitere Teile Tendenzen in diese Richtung aufweisen.
FPÖ und Gewerkschaften
Marxist:innen gehen nicht davon aus, dass die Arbeiter:innenklasse qua ihrer Existenz progressiv oder revolutionär ist. Qua ihrer Existenz ist sie die Grundlage des Kapitalismus und wird ausgebeutet. Revolutionär wird die Klasse nicht durch die Ausbeutung, sondern durch das Aufbegehren gegen diese. Ein Indikator für das Bewusstsein der eigenen Klassenposition ist die Mitgliedschaft in Gewerkschaften.
Viele soziologische Studien legen die Erklärung nahe, dass Gewerkschaftsmitglieder deutlich seltener rechtsextreme Parteien wählen. Kollektives Engagement soll eine Impfung gegen Rechtsextremismus sein. Das Problem ist, so eindeutig sind die Zahlen für Österreich nicht. Die Friedrich-Ebert-Stiftung publizierte 2023 den Sammelband „TRADE UNIONS AND RIGHT-WING POPULISM IN EUROPE“, indem auch die FPÖ in einem Kapitel behandelt wird. Gewerkschaftsmitglieder wählen in deutlich höheren Anteilen SPÖ als Nicht-Mitglieder. Jedoch war die FPÖ-Wähler:innenschaft unter Gewerkschaftsmitgliedern bei den Wahlen 2013 und 2017 nicht deutlich niedriger als unter den nicht Mitgliedern. Bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 wählten bspw. 45 % der wählenden Gewerkschaftsmitglieder den FPÖ-Kandidaten Hofer.
Bei den Wahlen zur Arbeiterkammer wie auch zu Betriebsratswahlen zeigt sich noch ein anderes Bild. Hier sind die SPÖ-Nahen und ihre Fraktion FSG deutlicher stärker als die FPÖ-Fraktion. Jedoch deuten Interviews mit SPÖ-nahen Gewerkschaftern und Betriebsräten für den Sammelband auf zwei Tendenzen hin. Erstens, in Regionen, in denen die FPÖ generell viele Stimmen erhält, insbesondere Oberösterreich, sind die freiheitlichen Arbeitnehmer besonders stark. Zweitens, in den industriellen Gewerkschaften Bau-Holz und PROGE, wohingegen sie in der größten und eher dienstleistungsorientierten Gewerkschaft GPA deutlich schwächer sind.
In Wien erreichten die Freiheitlichen Arbeiternehmer bei den AK-Wahlen 2024 8%, Steiermark 13%, Oberösterreich 15%. Wichtig ist auch, dass bei AK-Wahlen die Wahlbeteiligung niedrig ist (unter 50%) und nicht über jene Fragen abgestimmt werden, welche die FPÖ stark machen. Es geht nicht um Migration, nicht um Elitenhass, sondern eher darum, wem traue ich zu, mich am Arbeitsplatz zu vertreten.
Zusammenfassend:
- Die rassistische Stimmungsmache der vergangenen Jarzehnte, kombiniert mit den Niederlagen der Linken, haben dazu geführt, dass relevante Teile der Arbeiter:innenklasse für rechte Propaganda erschlossen wurden.
- Diese Zugewinne sind in historischen Kernsegmenten der Arbeiter:innenbewegung, die der Neoliberalismus besonders stark bluten ließ, zu beobachten.
- Gewerkschaftsmitgliedschaft ist eine Bremse, jedoch kein Stopp des FPÖ-Aufstiegs.
- Der Anstieg ist nicht einfach durch den Wechsel von links nach rechts oder eine ökonomische Rechnung zu begründen.
- Ein weiterer relevanter Teil der Arbeiter:innenklasse wurd durch die rassistische Knüpfung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen.
- Ein dritter Teil ist politisch so demobilisiert, dass er sich nicht mehr an den Wahlen beteiligt.
Ideologisch ist die FPÖ ganz klar keine Arbeiter:innenpartei. Ihre Politik ist für die Reichen und die selbsternannte Elite der Burschenschaften und sie verachtet die Arbeiter:innen. Trotzdem wird sie von einem nicht zu ignorierenden Teil der Arbeiter:innen gewählt. Dieser Widerspruch, dass Parteien, die Politik fürs Bürgertum machen, von Arbeiter:innen gewählt werden, ist auch durch das Gift der Demobilisierung zu erklären. Davon abgesehen ist es auch keine einzigartige Entwicklung, auch die NSDAP konnte Arbeiter:innen für sich überzeugen.
Gift der Demobislieirung
Leider verheißt das Geschriebene wenig Gutes für die Zukunft. Neoliberale Wirtschaftspolitik wird weiterlaufen, gesellschaftliche Krisen zunehmen, und eine SPÖ, die es unter dem linkesten Vorsitzenden seit 1945 in der Opposition nicht geschafft hat, die Wut der Leute einzufangen, wird es in der Regierung keinesfalls gelingen. Die KPÖ könnte dies potenziell, muss bei diesem Versuch jedoch auch offensiv auf Antirassismus setzen, um die verlorenen Arbeiter:innen zurückzugewinnen.
Was jetzt?
Der Trend zur Demobilisierung der Klasse spricht aus den zitierten Studien. Die Angst vor sozialem Abstieg, der Ausschluss am Arbeitsplatz, der sich in der weiteren Gesellschaft reproduziert, das sind Phänomene, welche die Arbeiter:innenbewegung seit ihrem Entstehen prägen. Klassenbewusstsein oder Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft zeigen nur, dass man sich der Probleme bewusst ist, nicht dass man den Schritt zu einer Lösung gefunden hat. Der britische Marxist Tony Cliff differenzierte zwischen dem Klassenbewusstsein und dem Klassenselbstvertrauen. Man kann sich seiner Lage maximal bewusst sein und trotzdem nichts dagegen unternehmen. Schlicht und ergreifend, weil man keine Möglichkeit sieht. Gerade dieser Zustand der aktivitätslosen Unzufriedenheit führt zu depressivem Zynismus oder im schlimmsten Fall zur Annahme rassistischer Welterklärungen.
Für die radikale Linke wird es im ersten Moment darum gehen, mit den noch nicht demobilisierten Segmenten der Arbeiter:innenklasse in Aktivität zu kommen. Nur durch diese gemeinsame Praxis kann ein Widerstand von links wieder sichtbar werden und eine Form des Selbstvertrauens, dass man Kämpfe gewinnen kann, erzeugt werden. Dieses Selbstvertrauen wieder zu vermitteln ist die entscheidende Frage, nicht die leidigen Diskussionen um die Schein-Trennung von „ökonomischen“ oder „gesellschaftlichen“ Fragen. Durch die kollektive Aktion mit dem noch kämpferischen Segment des Proletariats kann es gelingen, die aktuell für uns verlorenen Teile der Arbeiter:innenklasse wiederzugewinnen.