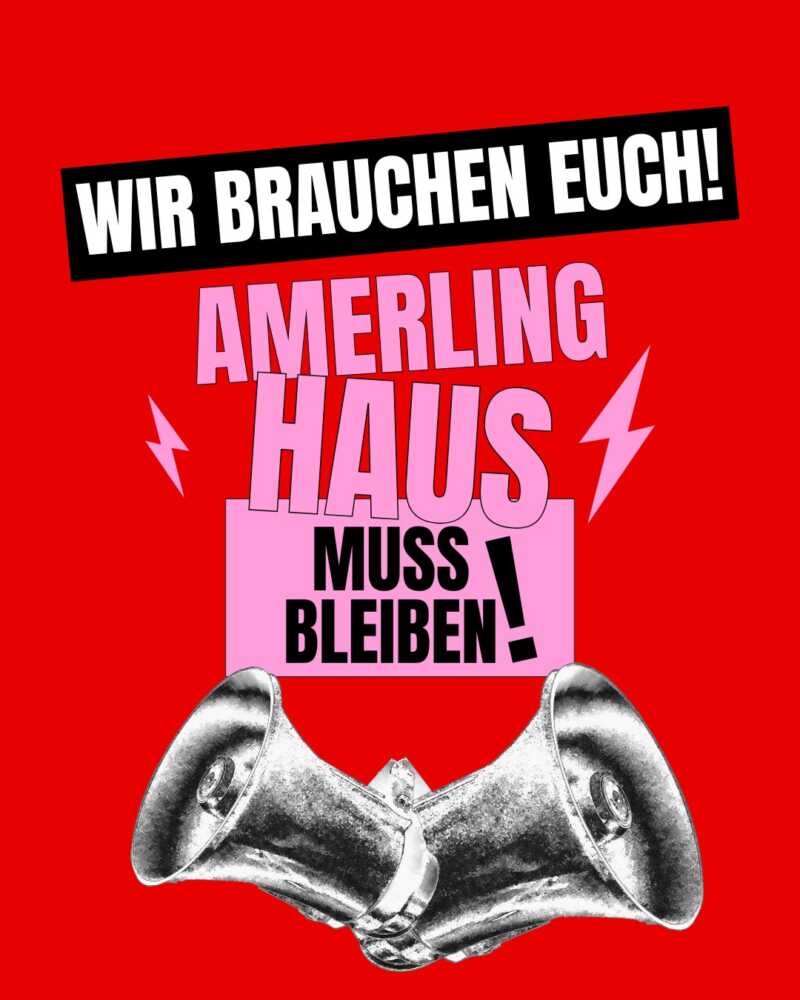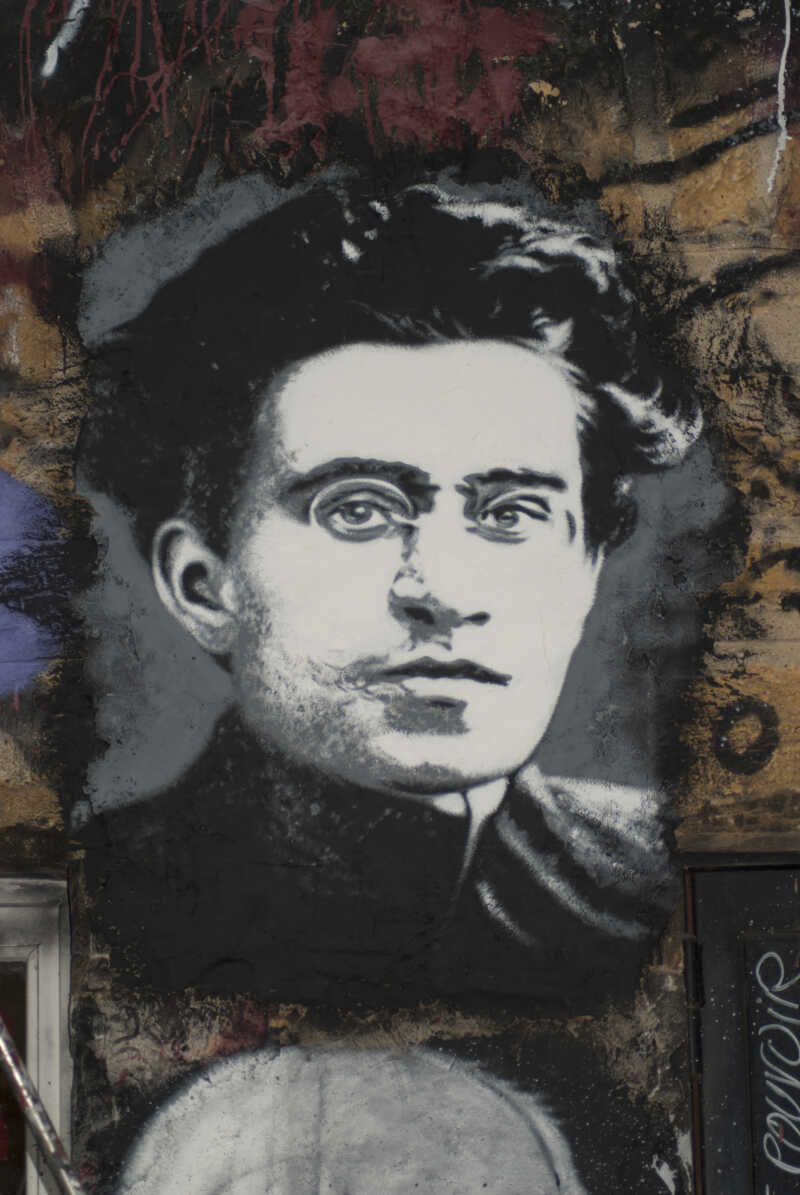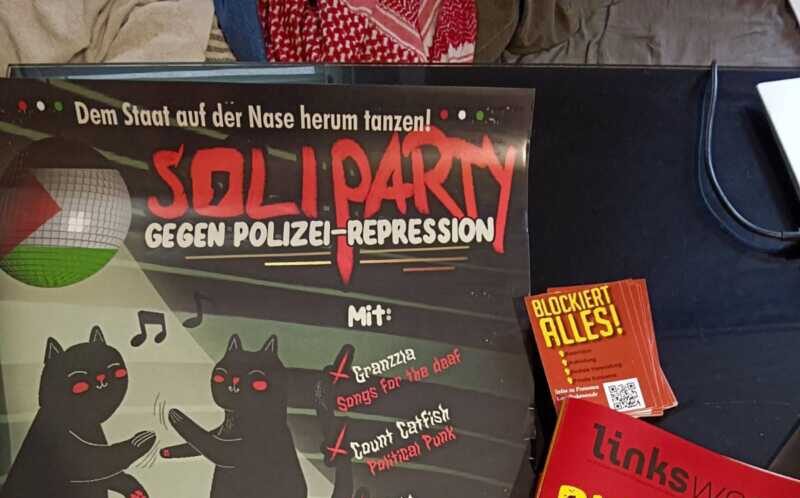Die „Campaign for Psychiatric Abolition“, die von psychiatric survivors aus Großbritannien im März 2021 gegründet wurde, hat mich zu einer radikalen Abolitionismus Perspektive hinsichtlich der Institution Psychiatrie inspiriert.
In einer Broschüre erklärt sie: „[…] Wir fordern nicht das Ende der psychischen Gesundheitsfürsorge, sondern bitten schlicht darum, dass sie überhaupt erst entsteht – wir verdienen eine Welt, in der wir tatsächlich heilen können, statt eines Systems, das Traumata reproduziert. Wir kämpfen für eine patientenzentrierte, gemeinschaftliche Versorgung, in der uns die Gewalt von Armut, Rassismus, Inhaftierung und Kolonialismus nicht in den Wahnsinn treibt. Eine Welt, in der wir uns wirklich umeinander kümmern können, in der unsere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und Wahnsinn nicht als individuelles Versagen, sondern als größerer Anreiz zur Stärkung unserer Gemeinschaften angesehen wird.[…]“
Wenn man aufhört über Reform zu sprechen und anfängt über Abolition nachzudenken, wird immer infrage gestellt, was man über die jeweilige Institution gesagt oder implizit vermittelt bekommen hat. Schützt die Polizei uns wirklich? Sind wir sicher durch Gefängnisse? Können wir alle mit genug Anstrengung Wohlstand erreichen? Hilft und heilt uns die Psychiatrie? Deckt sich das mit der eigenen gelebten Erfahrung? Ich denke, es macht keinen Sinn zu behaupten, dass der Zweck eines Systems darin besteht, das zu tun, was es offensichtlich fortwährend versagt zu tun.
Fakt ist, dass Zwangseinweisung das Suizidrisiko erhöht, nicht verringert… dass die Wahrscheinlichkeit, erneut in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden, mit jeder vorherigen Hospitalisierung steigt… dass die Risiken von psychiatrischen Drogen oft schlimmer und schwerwiegender sind, als die Erfahrungen, wegen denen sie verschrieben werden… dass Zwangsmaßnahmen, wie „Fixieren“, Zwangsmedikation, 24h-Überwachung, Elektroschocktherapien und Isolationshaft nicht Ausnahmen, sondern Teil von Behandlungsleitfäden sind.
Die Psychologie ist in unserer kapitalistischen Klassengesellschaft entstanden und spiegelt aufgrund dessen auch die Ideologie der herrschenden Klasse wider. Deshalb ist die massive Expansion der Institution in den letzten Jahrzehnten ein immer größer werdender Faktor darin geworden, soziale Probleme zu entpolitisieren, indem es unser Leid individualisiert und somit repressive Verhältnisse im Kapitalismus normalisiert. Das passiert mitunter, indem die zirkuläre essentialistische Logik der Psychiatrie den ideologischen Rahmen um Zwang, Überwachung und strukturelle Ausgrenzung zu legitimieren, liefert.
Kritik an der Psychologie muss wieder radikal werden. Dafür braucht es Raum für ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Institution – nicht nur die Positiven. Stigmatisierung muss als Teil struktureller Diskriminierung erkannt werden. Antipsychiatrischer Aktivismus muss intersektional gedacht sein und die Autonomie von Menschen, die als psychisch krank gelabelt werden, in den Mittelpunkt stellen. Um nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel zu schaffen, der bestehende Macht- und Unterdrückungsverhältnisse nicht reproduziert, müssen die Perspektiven der am stärksten marginalisierten Menschen als Ausgangspunkt dafür verstanden werden.
Seit 2022 organisiert die „Campaign for Psychiatric Abolition“ deshalb jährlich in London die „Mad Pride“ – einen radikal anti-psychiatrischen Protestmarsch. Dabei wird solidarische Unterstützung voneinander durch psychische Krisen gefeiert, ebenso wie eine kollektive Rückforderung der Freiheit, sich jenseits psychiatrischer Narrativen selbst zu definieren. Teil von ihrem Aktivismus beinhaltet außerdem, dass sie das Konzept und die Praxis der „harm reduction“ vom Thema Sucht hin zu Selbstverletzung, Psychopharmaka, Essstörungen und Suizidalität ausgeweitet haben. Es wird auf kollektive Unterstützung voneinander gesetzt, anstatt auf staatlich finanzierte „Unterstützung“ von oben. Aus der gleichen radikalen Kritik ist auch das „Weglaufhaus – Villa Stöckle“ entstanden – eine antipsychiatrisch orientierte Kriseneinrichtung in Berlin, die von (Psychiatrie-)Betroffenen und solidarischen Gleichgesinnten getragen wird. Hier wird „Wohnungslosen oder akut von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen in Krisen die Möglichkeit gegeben, sich dem psychiatrischen System zu entziehen.“
Sophia
Leser*innen-Briefe spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.