Dancing in Damascus
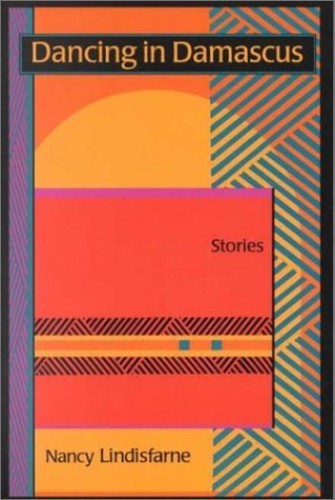
Eigentlich wollte Nancy Lindisfarne den Besuch bei einer Studienkollegin in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Einstieg in Studien zur dortigen Arbeiter_innenklasse nutzen. Durch Zufall geriet sie mitten hinein in die zwischen Tradition und „Modernisierung“ nach westlichem Vorbild schwankende Heiratspolitik einer ebenso schwankenden Mittelklasse. In neun Kurzgeschichten schildert sie den Alltag einer Gesellschaft in der Diktatur, erzählt von Identitätssuche, Geschlechterrollen und den Kämpfen um ein selbstbestimmtes Leben.
Politischer Widerstand in der Ironie
Am Steuer eines Taxis bringt der Ich-Erzähler einen Mann nach Damaskus. Im Gespräch stellt sich heraus, dass dieser nach Jahren im Gefängnis zur Familie heimkehrt. Politisch, erklärt er knapp. Mehr braucht es nicht an Erklärung in einem Land, das an jeder Ecke von Porträts des Diktators – dem Vater des jetzigen Assads – unter Beobachtung steht. Es sei die beste Geschichte in Dancing in Damascus, meint die Autorin im Gespräch mit Linkswende. Sie gab sie dem Freund, der ihr diese Begebenheit erzählte, zum Lesen, und er war erstaunt, weil er so etwas ähnliches selbst berichtet bekommen habe. „Yes!“, ruft Lindisfarne. Perfekt verwobene Fiktion, die den Urheber an seine eigene Geschichte erinnert.
Es ist ein Buch voller Widersprüche. Weil auch unsere Gesellschaft voll davon ist.
Eine andere Geschichte, „Not one of us“, lässt eine Mutter weinend von der Tochter erzählen, die zum Studium in die USA ging, dort den Schleier anlegte und sich dem Islam zuwandte, nämlich um die Frauenrechte zurückzufordern. Einer „westlichen“ Leserschaft, umgeben von sexistischen Kopftuch-Debatten und Bildern unterdrückter Frauen unter islamistischen Terroristen, muss die Szene irgendwie verdreht vorkommen. Lindisfarne lacht. Assads Regime will säkular sein. Frauen wird das Kopftuch abgerissen, Männern der Bart abrasiert. Obwohl Frauen alleine durch die Stadt spazieren können, weil bei jedem Mucks ein Scherge Assads zur Stelle ist, sind deren Augen eben auch überall. Kinos, Bars, Cafés werden geschlossen. Gerade für Frauen begrenzt sich das Sozialleben auf Familienfeiern. Und hier vor allem Hochzeiten. Mit Kopftuch aber konnte eine Frau ungehindert durch die Gegend fahren, unter dem Vorwand, ein religiöses Treffen zu besuchen. Denn diese zu verbieten, wagte nicht einmal Assad. Vor Volksaufständen ist man nie gefeit. Es war also eine Art von Widerstand. Es ermöglichte nicht nur Freiheiten, sondern auch, dem Regime ein Schnippchen zu schlagen.
Den Geschichten liegt nicht nur die politische Brisanz zu Grunde, sondern auch der ironische Blick. Die kleinen Dinge, die Menschen der Unterdrückung in ihrem Alltag entgegensetzen. Eine Mutter, die nie etwas anderes sein durfte, tut sich mit der verwitweten Nachbarin zusammen. Sie machen Witze über den Mann, der im Bett nur noch wie eine Schildkröte ist (so auch der Titel der Geschichte), und zweigen vom Haushaltsgeld, für die Mahlzeiten der Hausherren bestimmt, so viel ab, dass sie sich einen eigenen Fernseher kaufen können. Freiheit ist, wenn man selbst das Programm auswählen kann!
Die Socken des Piraten

„The pirate’s socks“, so nennt Lindisfarne ihr Nachwort. Es war der Name eines Ladens, an dem sie mit der Freundin vorbeifuhr. Für die beiden wurde er zum Inbegriff der Absurdität, die sie angesichts der syrischen Gesellschaft empfanden. Eine Situation voller Komik inmitten einer bedrückenden Realität. Dass die Anthropologin das Feld der wissenschaftlichen Abhandlung auf die Abwege der Fiktion verlässt, hat mehrere Gründe. Zunächst lassen sich Piratensocken akademisch schwer verkaufen. Und Menschen auf einer so persönlichen Ebene begleiten zu dürfen, verlangt danach, sie nicht nur als Forschungsobjekte zu präsentieren. Die akribische Analyse sollte ein Publikum außerhalb des akademischen erreichen. Das Buch erschien auch zuerst auf Arabisch in Syrien. Erst später auf Englisch. Ein kleiner Triumpf gegen die eurozentristische Norm.
Die Geschichten wurden in Rücksprache mit ihren Protagonist_innen veröffentlicht. Eine flog sogar aus der Sammlung – es ist nicht immer angenehm, die eigene Welt präsentiert zu bekommen. „Ich wusste nicht, dass sie mich so sehr hassen“, war eine andere Reaktion einer dem Regime nahestehenden Frau. Sie nahm es mit Humor und die Geschichte blieb. Auch die eigene Ablehnung der besitzenden und herrschenden Schicht gegenüber reflektiert Lindisfarne, die inneren Konflikte sich innerhalb der verhassten Elite zu bewegen, irgendwie dazuzugehören, Freundschaften darin zu finden und doch diese Klasse stürzen zu wollen. Es ist ein Buch voller Widersprüche. Weil auch unsere Gesellschaft voll davon ist.


