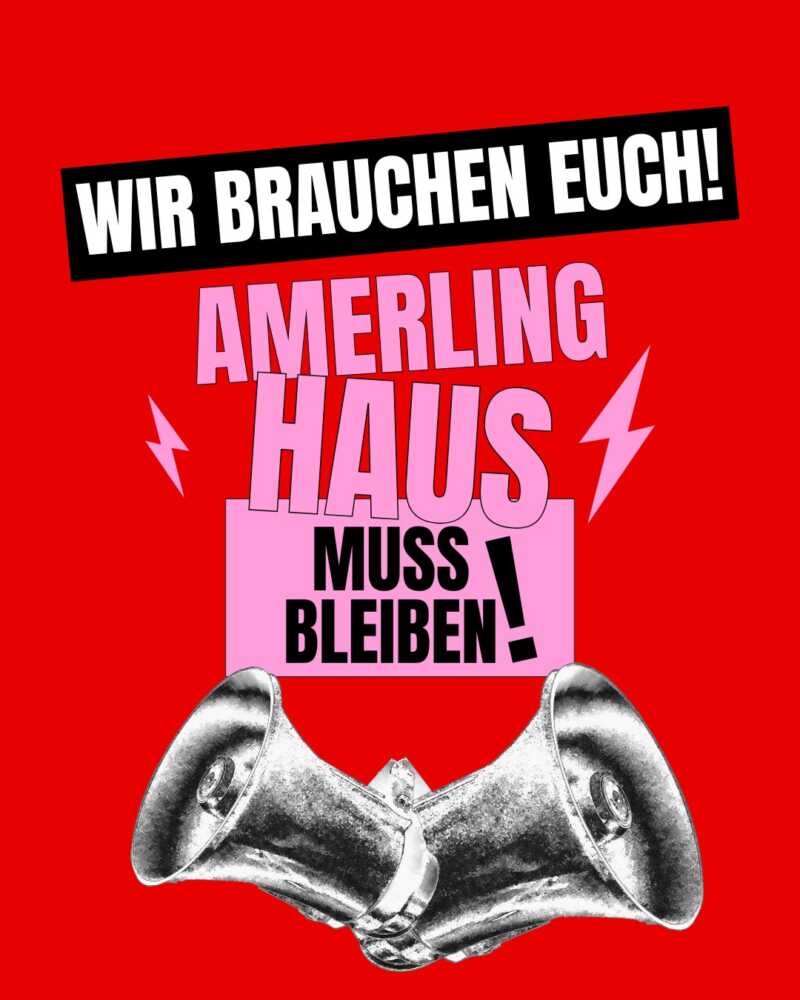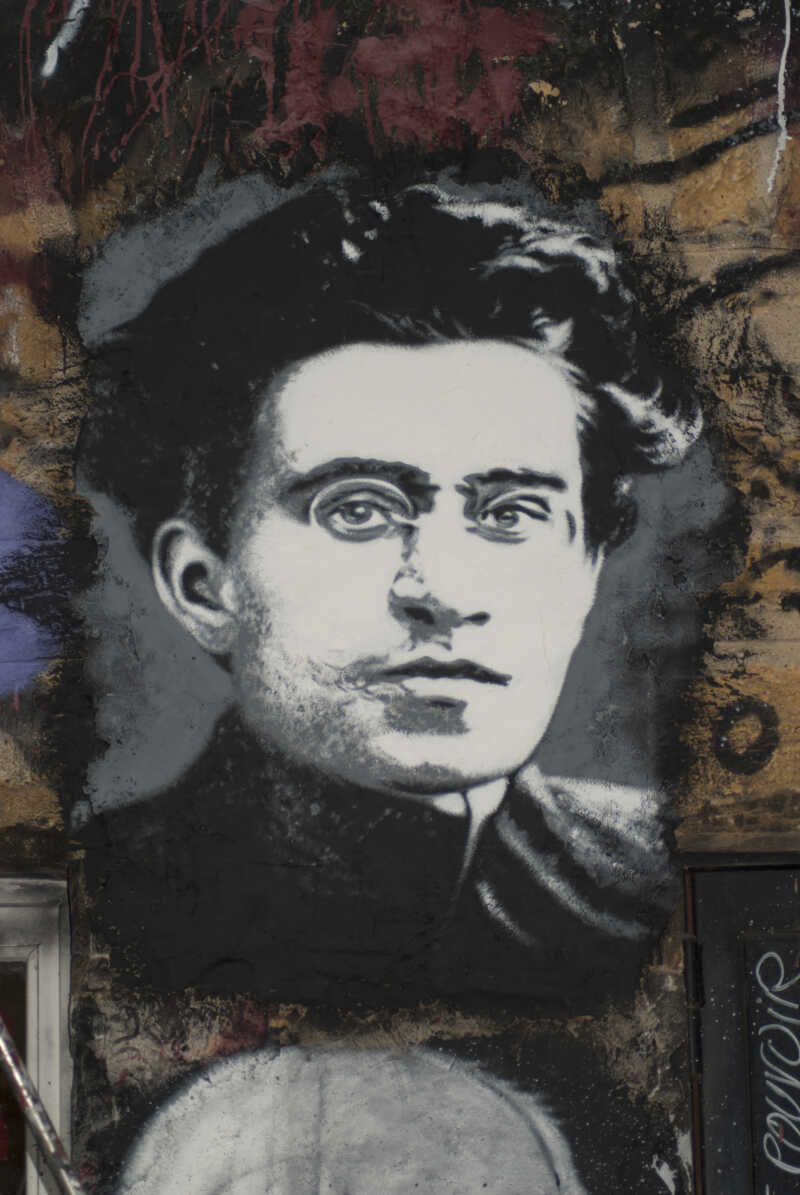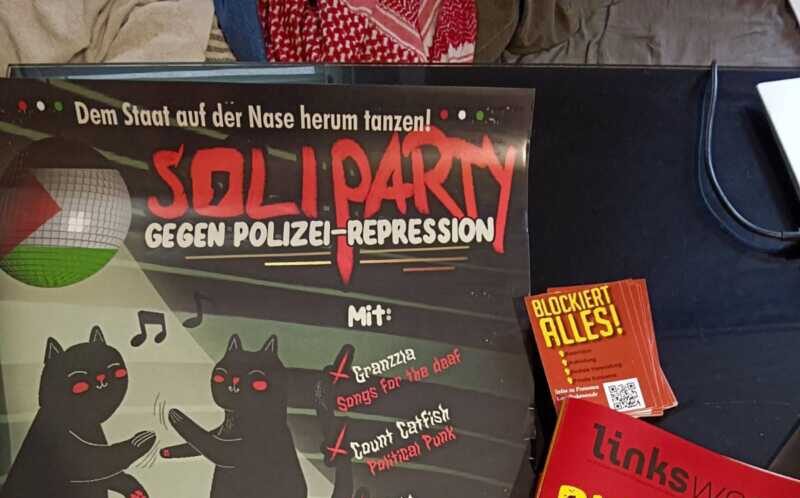Heute stehen sich China und die USA feindlich gegenüber. Anfang der 2000er Jahre war die These eines friedlicheren 21. Jahrhunderts nach dem Jahrhundert der Katastrophen eine verbreitete Illusion. Wie konnten sich die Beziehungen China-USA binnen zwei Jahrzehnten so verschlechtern? Ist der chinesische Staat ein kapitalistischer Staat wie alle anderen, ist er ein post-koloniales Aushängeschild oder sogar die sozialistische Vision fürs 21. Jahrhundert?
Die chinesische Revolution unter der Führung von Mao Zedong beendete das Jahrhundert der Demütigung. Nach der Niederlage im ersten Opiumkrieg 1839-42 wurde das chinesische Reich von Kolonialmächten besetzt, ausgeplündert und gedemütigt. In dieselbe Phase fällt die Loslösung Taiwans von China. Nach der westlichen Besatzung kam im Zweiten Weltkrieg die japanische, welche sich durch Massenvergewaltigungen und Tötungen an den Grenzen zum geplanten Völkermord bewegte. Im Zweiten Weltkrieg unterstützten die USA die bürgerlichen Widerstandskämpfer der Kuomintang gegen Japan, während der kommunistische Widerstand auf sich allein gestellt blieb. Durch die Mischung aus militärischem Geschick, kommunistischer Disziplin und Massenbegeisterung der Bauern für die Landreform, konnte Mao die bürgerliche Kuomintang besiegen, die sich nach Taiwan zurückzog. Die Gründung der sozialistischen Volksrepublik China 1949 war eine der brutalsten weltgeschichtlichen Ohrfeigen für den US-Imperialismus. Nach dem 2. Weltkrieg verfolgten die USA die Strategie des „Containment“ – der Eindämmung der Ausbreitung des Sozialismus finanziell, diplomatisch oder militärisch – aber keine vier Jahre später übernehmen Kommunist:innen im bevölkerungsreichsten Land der Welt die Macht.
Eingliederung Chinas
Die erste Reaktion der USA war ein beleidigtes Ignorieren Chinas. Der globale Süden erkannte in China ein anti-koloniales Vorbild und setzte 1971 die Aufnahme Chinas in die Vereinten Nationen durch. Die USA waren nicht begeistert, erkannten jedoch, dass China durch einen seit 1969 mit der Sowjetunion schwelenden Grenzkonflikt für diplomatische Annäherung offen wäre. 1972 besuchte Nixon als erster US-Präsident China, womit eine Phase der diplomatischen Entspannung und beginnender US-Investitionen einsetzte.
1979-1997 übernahm Deng Xiaoping die Macht und setzte auf eine Phase der ökonomischen Öffnung, wodurch man sich weiter von der Sowjetunion entfernte und den USA annäherte. China konnte im globalen Kapitalismus die Rolle als Billig-Produktionsstandort gewinnen. In einem Punkt blieben die USA gegenüber China aber hart. In den „Sechs Zusicherungen“ (Six Assurances) 1982 erklärte Reagan, dass die USA Chinas Anspruch auf Taiwan niemals anerkennen würden und sie außerdem Taiwan militärisch aufrüsten würden. Die US-Unterstützung hatte nichts mit einer Mission der Demokratie zu tun, sondern sollte China Schranken aufzeigen. 1982 wurde Taiwan noch diktatorisch von den Nachfahren der Kuomintang regiert.
Keine Unterwerfung
Viele US-amerikanische Strategen gingen davon aus, dass eine marktwirtschaftliche Liberalisierung zu einer politischen Unterwerfung Chinas führen würde. Ende der 1980er-Jahre erschütterten Revolten die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten. Auch wenn diese Protestbewegungen keine rein pro-westlichen Bewegungen waren – geschweige denn von den USA intonierte Proteste – führte die Machtablöse der kommunistischen Partei und der folgende Verkauf der teilstaatlichen Wirtschaft zugunsten von westlichen Unternehmen und lokalen mafiösen Herrschercliquen, zu einer Stärkung des US-Imperialismus. In China kam es 1989 ebenfalls zu Massenprotesten von Studierenden und Arbeiter:innen (Tiananmen-Bewegung) für einen anderen politischen Weg. Im Unterschied zur Sowjetunion besaß die KP-Chinas noch genügend Skrupellosigkeit und Macht, die Aufstandsbewegung militärisch niederzuschlagen. In den 90er-Jahren war China der letzte mächtige Staat, der sich dem westlichen Weg scheinbar widersetzte. Im Unterschied zu heute fehlte aber die wirtschaftliche Dominanz.
Der Westen setzte weiter auf die ökonomische Integration Chinas. 2000 wurden die Handelsbeziehungen endgültig normalisiert, 2001 trat China der Welthandelsorganisation (WTO) bei. Doch die Öffnung Chinas wurde für den Westen zu einem Bumerang, dem sich die US-Strategen langsam aber sicher bewusst wurden. Der Strom des westlichen Kapitals nach China führte dazu, dass der Westen in eine langsame, aber stetige Abhängigkeit der chinesischen Industrie geriet. Westliches Geld schuf chinesische Fabriken, mit denen westliche Fabriken nicht mehr mithalten konnten. War die Abhängigkeit von Billigprodukten geopolitisch sekundär, wurde die Abhängigkeit von chinesischer Schwerindustrie und Medikamentenherstellern zumindest für protektionistisch denkende Politiker langsam zum Problem. In der entspannten Phase des globalen Handels der 2000er konnte dieses Problem noch ignoriert werden. Heutzutage klagt der Westen über Technologiediebstahl – ein Synonym für Know-how-Transfer – den er selbst zu seinem ökonomischen Nutzen befeuert hatte.
Chinas ökonomischer Triumph
Zu der Industrieproblematik kamen Mitte der Nullerjahre zwei weitere Probleme: China überholte 2006 Mexiko und wurde zum wichtigsten US-Handelspartner. Gleichzeitig wurde China neben Japan zum größten Gläubiger der USA. Das bedeutet, dass China durch Staatsanleihen-Verkauf bzw. die Androhung eines solchen Verkaufes den Wert amerikanischer Staatsanleihen mitbestimmen kann. Zur veränderten industriellen und finanzwirtschaftlichen Machtbeziehung kam noch eine ressourcentechnische. Durch eine Kombination aus geologischen Zufälligkeiten und wirtschaftspolitischer Weitsicht kontrolliert China den Großteil der globalen Vorkommen an „kritischen Mineralien“, wie Cobalt oder Lithium. Diese werden nicht nur für Computerchips und Akus benötigt, sondern auch für moderne Hightech-Waffen. Im Kriegsfall hätte China eine gute Ausgangsposition, den Westen von diesen Mineralien auszuschließen – ähnlich wie die Alliierten im 2. Weltkrieg die Nazis von den Öl-Ressourcen ausschlossen. Aktuell versucht der westliche Block alles, um in diesem Wettlauf um Ressourcen-Kontrolle aufzuholen u.a. durch neo-koloniale Wirtschaftsverträge mit der Ukraine und einigen afrikanischen Staaten.
Diese ökonomischen Entwicklungen führten für die USA zu einer unangenehmen Situation. Zum ersten Mal stehen sie vor einem Konkurrenten, der wirtschaftlich ebenbürtig oder gar überlegen ist. Das wilhelminische Deutschland, das Dritte Reich, die Sowjetunion, sie alle waren den USA ökonomisch unterlegen – sie erreichten nicht mal 60 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes. Bereinigt nach der Kaufkraft der Länder hat das BIP der Volksrepublik China jenes der USA bereits im Jahr 2016 überholt. Zyniker würden sagen, dass die USA von China auf ihrem eigenen Spezialgebiet, dem Kapitalismus, geschlagen wurden.
USA neuer Fokus auf China
Der ökonomische Aufschwung Chinas fand in einer Phase des besonders aggressiven US-Imperialismus statt. Oft wird angenommen, dass die Welt nach Ende der Sowjetunion durch das Wegfallen von Stellvertreterkriegen zu einem friedlicheren Ort wurde. Die Realität sieht aber genau umgekehrt aus. Die vom US-Kongress beauftragte Studie „ Use of United States Armed Forces Abroad 1798-2018“ zeigt, dass die US-Armee von ihren Anfängen bis zum Ende des Kalten Krieges 216 Auslandseinsätze durchführte. In den 25 Jahren nach Ende des Kalten Krieges waren es 152 Auslandseinsätze.
Die USA wollten ihre Position als weltweiter Hegemon dazu nutzen, unliebsame Regierungen militärisch zu disziplinieren. Marxist:innen übersehen viel zu oft, dass diese Phase der totalen US-Hegemonie in einer Niederlage endete. Bush erklärte Irak, Iran und Nordkorea in den 2000ern zur Achse des Bösen. Das Regime in Nordkorea existiert nach wie vor, die Angriffe auf den Irak und Afghanistan endeten in einer doppelten Niederlage. Der islamistische Widerstand in beiden Staaten zwang die USA zum Rückzug und der Iran konnte aus der US-Niederlage Profit schlagen und seine Macht ausweiten. Die militärischen Fehlschläge in Afghanistan und Irak fielen in eine Zeit, in der die globale Hegemonie der USA durch einen kapitalistischen Konkurrenten gefährdet wurde. Aus dieser Perspektive waren die Niederlagen in Afghanistan und Irak für die USA verheerender als die in Vietnam.Die Niederlage in Vietnam führte zwar zum dauerhaften US-Rückzug aus der Region, aber ihre globale Vormachtstellung war durch ihren Hauptkonkurrenten Sowjetunion nie gefährdet. Die USA reagierten auf die Niederlage und die veränderte globale Machtverhältnisse mit einer agressiven „Wendung nach Asien“. Diese Strategie der Einschüchterung Chinas begann unter Obama und wurde von Außenministerin Hillary Clinton in einem Essay 2011 „America’s Pacific Century“ ausformuliert.
Die USA verlegten Truppen und Flugzeugträger in den asiatischen Raum und fuhren insbesondere im südchinesischen Meer Patrouillen zur Einschüchterung Chinas. Diese Schiffspatrouillen sollen auch verhindern, dass atomar bestückte U-Boote aus dem südchinesischen Meer nach Belieben in den Pazifik fahren können. Dadurch sollen die Zweitschlagkapazitäten Chinas im Falle eines Atomkriegs eingeschränkt werden. Den Höhepunkt erreichte das anti-chinesische Säbelrasseln unter Biden, als die NATO China 2021 zur Bedrohung erklärte.
Chinas Imperialismus
In seinem sehr lesenswerten und chinafreundlichen Buch „Hat China schon gewonnen“ präsentiert der Politikwissenschaftler Kishore Mahbubani drei für uns relevante Beobachtungen: 1. Es ist einzigartig, dass ein ökonomischer Aufschwung wie jener Chinas nicht zu einem Aufschwung an militärischen Interventionen führte. 2. Die bestimmende Angst der herrschenden Klasse ist jene vor Gespaltenheit und Chaos (Die Zerrissenheit des alten Chinas machte es zur leichten Beute für den westlichen Kolonialismus.) 3. In den internationalen Beziehungen arbeitet China teilweise an einer Demokratisierung, insofern es fordert dass Staaten kein Recht haben sich in die innenpolitischen Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. „Wenn wir mit dem Westen kooperieren, bekommen wir Vorträge über Frauen-, Schwulen- und Oppositionsrechte mit China neue Krankenhäuser und Schulen“ so geht eine gern zitierte Sichtweise des Globalen Südens auf den Unterschied in der internationalen Beziehungen.
Wir sollten Mahbubanis Sicht nicht völlig übernehmen. Durch sein richtiges Bedürfnis, China gegen die westliche Hetze zu verteidigen, sieht er überhaupt keinen chinesischen Imperialismus. Dass China noch keinen großen Kriege geführt hat, ist korrekt, der wirtschaftliche Aufschwung Chinas beruht jedoch gerade in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf einer ökonomischen Ausbeutung des globalen Südens. Mit Kooperationen zum beidseitigen Vorteil hat der chinesische Abbau von seltenen Erden, Aufkauf von Häfen und Landflächen im globalen Süden nichts zu tun. Imperialismus kann als Verschmelzung von unternehmerischen ökonomischen Interessen und staatlichen geopolitischen Interessen verstanden werden. Der Export von Kapital beim Import von Rohstoffen, wie er von China betrieben wird, ist der imperialistische Normalzustand. Aufgrund dieser wirtschaftlichen Logik ist China ein imperialistischer Staat, auch wenn er bisher keine Kriege geführt hat.
Re-Ideologisierung als Verteidigung
Auch die chinesische KP reagierte auf das US-Bedrohungsszenario. Nach Mao wurde die Macht der Generalsekretäre der Partei zugunsten des etwa 20-köpfigen Politbüros des Zentralkomitees verschoben. Die sehr China-kritischen Politikwissenschaftler:innen Olivia Cheung und Steve Tsang stellten in ihrem Buch „The Political Thought of Xi Jinping“ dar, wie diese Machtverschiebung im Westen die Hoffnung auf eine Spaltung der KP vermehrte. Verstärkt wurde diese Hoffnung noch durch das System, in dem 32 Verwaltungseinheiten als innerchinesische politische und ökonomische Machtzentren existieren, die zu keiner konsistenten Politik fähig sind. Die Menge an abgeschlossenen, aber nicht gebrauchten Infrastrukturprojekten – 80 Millionen leerstehende Wohnungen, leere Autobahnen, geringe Nutzung der Hochgeschwindigkeitszüge – sind ein Beleg für das Fehlen eines gesamtchinesischen Entwicklungsplans.
Die Machtübergabe an Xi Jinping war eine Reaktion auf diese Spaltungstendenzen. Er festigte die Partei und konzentrierte sie durch drei strategische Schritte auf seine Person. Erstens setzte er auf eine intensive Antikorruptionskampagne (4 Millionen Ermittlungen) – diese nutzte er auch zur Ausschaltung von Gegenspielern – wodurch sein Ansehen innerhalb der Gesellschaft und Parteibasis wuchs. Zweitens fokussierte Xi Jinping die Macht wieder auf den Generalsekretär, bspw. dadurch, dass seit 2018 Mitglieder der Polit-Büros ihm persönlich, und nicht mehr dem Zentralkomitee, rechenschaftspflichtig sind. Drittens wurden staatliche Organisationen, insbesondere das Militär, wieder stärker unter Parteikontrolle gestellt.
Mit diesen strategischen Änderungen ging eine Re-Ideologisierung (Order No. 9 über westlichen Einfluss 2013) einher. Der Begriff des Sozialismus chinesischer Prägung, die positive Bezugnahme auf Marx und auch Lenin, ist wieder allgegenwärtig geworden. In einer viel beachteten Rede an die einfachen Kader der Partei forderte Xi die Neuhärtung der Partei: „Manche unserer Kader glauben nicht mehr an Marx und Lenin, sondern an Gespenster und Götter. Sie suchen spirituelle Substanz im feudalen Aberglauben und sind besessen von Weissagungen. Manche haben sogar eine Sehnsucht nach westlichen politischen Werten und verlieren den Glauben an den Sozialismus“.
China ist kein sozialistischer Staat dafür würde es die Herrschaft der Arbeiter:innenklasse benötigen, nicht die einer Parteibürokratie. Die positive Bezugnahme auf den Sozialismus chinesischer Prägung zielt darauf, der Gesellschaft eine kohärente ideologische Grundlage zu vermitteln, um diese als Machtbaustein in der geopolitischen Konfrontation mit dem Westen einzusetzen. Die seit Mitte der 2010er-Jahre einsetzende rhetorische Härtung und militärische Aufrüstung Chinas sind aber mehr eine Reaktion auf, statt Auslöser dieser bedrohliche geopolitische Lage.
Staatlich gelenkter Kapitalismus
Schon der Beginn des „Sozialismus mit chinesischer Prägung“ hatte wenig mit Sozialismus im Sinne von Marx und Lenin zu tun. Die Arbeiter:innenklasse spielte in der chinesischen Revolution keine Rolle, wodurch es auch nicht zur Formierung demokratischer Institutionen kam.
Das Fehlen einer demokratischen Rolle der Arbeiter:innenklasse zeichnete die Geschichte Chinas nach der Revolution aus. Wenn die Arbeiter:innenklasse versuchte, Reformen durchzusetzen, wurde sie von Staat und Partei ein ums Andere Mal niedergeschlagen. Streiks wurden verboten, Streikführer erschossen, Aufstände niedergewalzt – das ist die innenpolitische Geschichte Chinas. Ökonomisch besitzt der Staat noch immer stärkere Zugriffsmöglichkeiten als in jedem westlichen Land. Mit einer planwirtschaftlichen Ausrichtung hat dies jedoch nichts zu tun. Viel eher beruht die chinesische Wirtschaft auf einer Machtvielfalt von lokalen Parteiautoritäten, Einzelkapitalist:innen und dem staatlich kontrollierten Finanzsektor. Der Marxist Adrian Budd charakterisiert China als „staatlich gelenkten Kapitalismus“ welcher zwischen dem westlichen neoliberalen Modellund dem historischen sowjetisch-staatskapitalistischen changiert.
Taiwan der nächste Krieg
Im Konflikt über Taiwan haben China und die USA einen Punkt erreicht, von dem es kein Zurück mehr gibt. Neujahr 2025 bestätigte Xi erneut, dass die Eingliederung Taiwans in die chinesische Volksrepublik nicht verhandelbar sei. Ideologisch steht eine Wiedereingliederung Taiwans für das endgültige Ende des Jahrhunderts der Demütigung. Die manchmal geäußerte Hoffnung, China muss keinen Krieg zur Eingliederung führen, sondern könnte versuchen, Taiwan wirtschaftlich und kulturell zurückzuerobern, ist keine völlige Illusion. Tatsächlich besteht ein enges Geflecht zwischen der taiwanischen und chinesischen Wirtschaft, die Bevölkerung Taiwans steht einer Eingliederung jedoch ablehnend gegenüber. Insofern ist es durchaus möglich, dass die Taiwan-Krise den Dritten Weltkrieg auslöst.
Als revolutionäre Linke sollten wir uns gegen einen Einmarsch Chinas in Taiwan aussprechen, aber ähnlich wie beim Ukrainekrieg keinesfalls die USA in einem Krieg gegen China unterstützen. Es wird ein Stellvertreterkrieg. Darum sollten wir uns an der Position „Weder Washington noch Moskau, sondern internationalen Sozialismus“ orientieren. Diese theoretische Position in politische Praxis zu verwandeln, bedeutet aktuell vor allem Kampf gegen Aufrüstung im eigenen Land sowie Mobilisierung gegen alle Kriegsdrohungen.