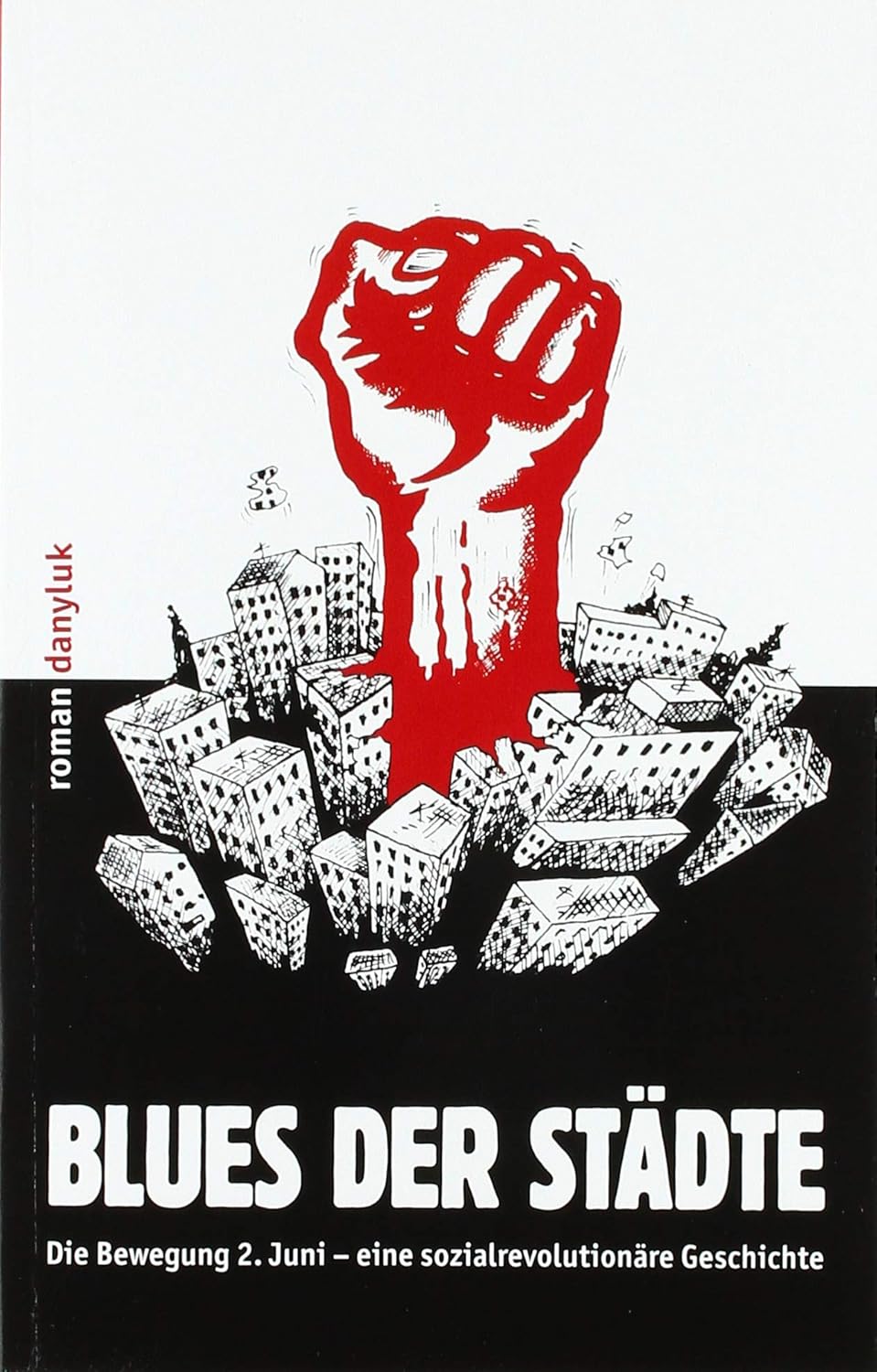In unserer Welt steht Gewalt auf der Tagesordnung. Menschen flüchten aus Kriegen, werden wieder in Kriegsgebiete abgeschoben und von der Polizei schikaniert. Der durch den Kapitalismus verursachte Klimawandel und die daraus entstandene Klimakrise wird weiter gewaltsam vorangetrieben. Der Wunsch, einer Welt voller Gewalt mit aktiver Gewaltlosigkeit etwas entgegenzusetzen und an die Menschlichkeit der Herrschenden zu appellieren, ist verständlich. Die prinzipielle Ablehnung von Gewalt ist aber gleichbedeutend mit der Unterwerfung vor der Gewalt des Gegners.
Auf der individuellen Ebene wirkt die Gewalt entgiftend. Sie befreit den Kolonisierten von seinem Minderwertigkeitskomplex, von seinen kontemplativen und verzweifelten Haltungen. Sie macht ihn furchtlos, rehabilitiert ihn in seinen eigenen Augen.“ Frantz Fanon, 1961
Geboren 1925 in eine kleinbürgerliche Familie auf Martinique, einer französischen Inselkolonie in der Karibik, wuchs Frantz Fanon in einer Gesellschaft auf, in der Schwarze als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden.
Im Zweiten Weltkrieg trat er der Armee bei, um gegen Faschismus zu kämpfen und verließ diese nach dem Krieg, desillusioniert vom dort herrschenden Rassismus. In Lyon studierte er Medizin und Philosophie und musste den Rassismus der französischen Polizei am eigenen Leib kennenlernen.
Er beschrieb seine Erfahrungen mit Kolonialismus und Rassismus 1952 in seinem ersten Buch „Schwarze Haut, weiße Masken“ und verwendete die Theorien von Hegel, Sartre und Marx zur Analyse. Ein Jahr später wurde er Chefarzt eines Psychiatrischen Krankenhauses in Algerien.
Seit dem 19. Jahrhundert waren die Algerier_innen durch die französische Kolonialmacht systematisch unterdrückt, ermordet und versklavt worden. Den grausamen Höhepunkt der Repression bildete das Massaker von Sétif. Anlass war der Aufstand gegen die französischen Besatzer vom 8. Mai 1945, dem Tag des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges. Als Vergeltung für die 102 französischen Opfer der Erhebung begann ein zweiwöchiges Blutbad an der muslimischen Bevölkerung. Massenerschießungen, Bombardierung von Dörfern und der Beschuss durch die Marine bildeten die Begleitmusik zu den ungehindert wütenden Bürgerwehren.
1954 begann die Nationale Befreiungsfront FLN mit dem bewaffneten Kampf gegen die Kolonialmacht. Fanon schloss sich ihr an und behandelte heimlich verwundete Kämpfer. Er gab seinen Chefarztposten auf, und konzentrierte sich ganz auf den Freiheitskampf, zunächst als Redakteur für die FLN-Zeitung, später als Botschafter für die provisorische Regierung.
Fanon machte in seinem Buch „Die Verdammten dieser Erde“ klar, dass es keinen Kolonialismus ohne Gewalt geben kann. Die gesamte koloniale Gesellschaft war auf Gewalt aufgebaut, dementsprechend war Gewaltanwendung nicht nur ein unvermeidbarer Teil des Widerstands, sondern der bewaffnete Kampf notwendig, um die Grundlage der Kolonialherrschaft zu zerstören.
Er sah im gemeinschaftlichen, gewaltsamen Aufstand eine Chance zur Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins hin zu einem befreiten, geeinten Volk. Gleichzeitig sollte die Bewaffnung der Massen vor dem Verrat der Revolution durch die Kleinbürger und Reformisten helfen, weil die chronisch zu Kompromissen mit den Herrschenden neigen.
Gewaltlosigkeit als politische Agenda
Im krassen Gegensatz zu Fanons Thesen argumentieren Pazifist_innen. Den verschiedenen Ausformungen der Theorien und Methoden ist eines gemein: die Ablehnung von Gewalt für den aktiven Kampf, egal ob gegen Menschen oder Dinge. Der wohl bekannteste Verfechter von gewaltlosem Widerstand war Mohandas Gandhi. Bis heute berufen sich zahlreiche Liberale aber auch linke Aktivist_innen auf seine Theorie des zivilen Ungehorsams.
Sein Konzept der Gewaltlosigkeit, das er unter dem Begriff „Satyagraha“ (Kraft der Wahrheit) lehrte, bezog er aus christlichen Schriften zu Gewaltlosigkeit und seinen Erfahrungen in Südafrika, wo die Segregation Inder_innen und Schwarze zu niederen Menschen deklassifizierte.
Als Gandhi nach seiner Ausbildung zum Anwalt in London und seiner Arbeit in Südafrika nach Indien zurückkehrte, halfen ihm seine strengen moralischen Vorgaben, hunderttausende einfacher Inder_innen in einer Bewegung gegen die britische Herrschaft zu vereinen. Er durchbrach Barrieren, wie das Kastenwesen und setzte sich für die sogenannten Unberührbaren, die unterste Kaste ein.
Sein Ziel war es, alle Inder_innen zu bündeln, egal aus welchem sozialen Hintergrund, mit welchem Religionsbekenntnis und welcher politischen Einstellung. Die Basis für seine Kampagnen bildete Nichtkooperation und ziviler Ungehorsam, wobei ihm absolute Gewaltfreiheit am wichtigsten war.
Während des Zweiten Weltkriegs versuchte Gandhi mit der Quit-India-Kampagne die britische Herrschaft in Indien zu beenden. Was als Satyagraha begonnen hatte, entwickelte sich schnell zu einer starken Streik- und Aufstandsbewegung. In ganz Indien kam es zu Arbeitsniederlegungen, Sabotageakten, Überfällen auf Polizeistationen und in manchen Regionen wurden eigenständige Regierungen gewählt. Zusätzlich zu der Repression durch den Staatsapparat begann Gandhi ein „Fasten bis zum Tod“ und zwang so die Aufständischen zur Aufgabe.
Im Jahr 1947 endete nach fast 200 Jahren Ausbeutung, Unterdrückung und Rassismus die britische Kolonialherrschaft in Indien. In der allgemeinen Geschichtsschreibung werden die gewaltfreien Kampagnen Gandhis als alleiniger Grund für die Befreiung Indiens genannt.
Ein Blick in den Briefwechsel zwischen Großbritanniens damaligem Premierminister Attlee und dem obersten Richter in Kalkutta Chakrabarty zeigt den tatsächlichen Grund für den raschen Abzug der Truppen. Die Aushöhlung der Treue gegenüber der britischen Krone innerhalb der Indischen Armee und Marine hatte das Land und die Bevölkerung unkontrollierbar gemacht.
Grund für diese Aussagen Atlees waren die Ereignisse 1946. Nach der Anklage dreier Offiziere der Indian National Army – ein Hindu, ein Moslem und ein Sikh – wegen Mordes, strömten nicht nur Menschen aller Religionen auf die Straßen, um gegen die Prozesse zu protestieren; die Soldaten der Royal Indian Navy meuterten aus Solidarität. Während der Meuterei kämpften alle gemeinsam, Hindus, Sikhs, Muslime, Parsi.
Die britischen Flaggen auf den Schiffen ersetzten sie mit denen der Hindupartei, der Muslimpartei und der Kommunistischen Partei, um die Einigkeit der indischen Bevölkerung zu demonstrieren. Tausende kamen zu den Docks, um den Meuterern Essen zu bringen und ihre Unterstützung zu zeigen.
Dieses Beispiel dieses indischen Zusammenhalts, über die Religionsgrenzen hinweg und zu gewaltsamen Widerstand bereit, fürchteten die Briten. Trotz des vereinten Kampfes kam es nach der Befreiung Indiens zur Teilung anhand der Religionszugehörigkeit und dem blutigsten Bürgerkrieg der Geschichte. Gründe dafür sind neben der britischen Besatzungsmacht bei den Parteiführern der Hindus und Moslems zu suchen.
Sie wollten um keinen Preis eine andauernde Meuterei, weil sie „die Armee auch im freien Indien brauchen würden“, und überredeten die meuternden Soldaten diese zu beenden. Auch Gandhi, der sich Zeit seines Lebens für die Einigung aller Inder_innen eingesetzt hatte, verdammte die Matrosen dafür, dass sie ein schlechtes Beispiel für Indien darstellten und ihr gewaltsamer Kampf unheilig sei.
Mit dem Verhindern der indischen Revolution durch die nationalen Führer wurde die indische Bevölkerung um eine aktive Rolle in ihrer Befreiung gebracht. So mussten sie passiv die ungerechte Teilung – von der alten Besatzungsmacht verfasst und von den neuen Herrschern abgesegnet – ertragen.
Alleine die Meuterei als Vorzeichen der Revolution konnte bereits landesweit Solidaritätskationen und einen Generalstreik mit 300.000 Demonstrierenden auslösen. Die reinigende Wirkung eines bewaffneten Aufstandes hätte ein geeintes Indien, wie Gandhi es sich zu Lebzeiten immer vorgestellt hatte, bringen können.
Widerstand im Zweiten Weltkrieg
Während des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung großer Teile Europas durch die Nazis bildeten sich in vielen Ländern bewaffnete Widerstandsgruppen. Sie kämpften meist ohne Unterstützung der Alliierten und bewiesen, dass die Nazis nicht unbesiegbar waren. Noch wichtiger waren der Einfluss auf den Verlauf des Krieges von Kämpfen und Sabotageaktionen der Partisan_innen.
Als das erste Opfer des Eroberungskriegs Hitlers war Polen seit 1939 besetzt. Stalin hielt sich während des Angriffs zurück und bekam als Belohnung die Hälfte des Landes zugesprochen. Bis 1941 war die polnische Bevölkerung im Westen unter deutscher und im Osten unter russischer Besatzung. In beiden Besatzungszonen wurden Hunderttausende Pol_innen deportiert, terrorisiert, gefoltert und umgebracht.
In dieser ausweglos erscheinenden Situation bildete sich der beeindruckendste Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Neben dem polnischen Staatsapparat, der im Untergrund arbeitete und von London aus geführt wurde, schossen hunderte selbstorganisierte Untergrund-Organisationen aus dem Boden.
Den geeinten Widerstand der polnischen Bevölkerung bekamen die deutschen Besatzer 1944 zu spüren, als sie nach dem desaströsen Russlandfeldzug auf dem Rückzug waren. Die aus dem Nichts erschaffene Polnische Heimatarmee rekrutierte 40.000 Freiwillige und konfrontierte die Nazis in der Hauptstadt Warschau.
Mehr als zwei Monate dauerten die verlustreichen Gefechte, bei denen die polnischen Milizen den militärisch weit überlegenen Nazis einigen Schaden zufügen konnten. Nach der Niederlage übten die Nazis grausame Rache und Stalins Armee „befreite“ die von Aufständischen gereinigte und zerstörte Hauptstadt Polens.
Bereits 1943 hatten die Aufständischen im Warschauer Ghetto bewiesen, dass Jüdinnen und Juden nicht nur passive Opfer des Nazi-Regimes waren. Die Nazis hatten nach ihrem Einmarsch die jüdische Bevölkerung in diversen Ghettos eingesperrt und zunächst versucht sie verhungern zu lassen. Das größte mit zeitweise 450.000 Inhaftierten befand sich in Warschau.
Nach der Erfindung von Zyklon B begannen die Deportationen in die Vernichtungslager. Die im Warschauer Ghetto gegründete und aus den wichtigsten Vorkriegsorganisationen rekrutierte Jüdische Kampforganisation ŻOB begann Anfang 1943 Waffen ins Ghetto zu schmuggeln und selbst zu bauen. Der größte Teil der Jüd_innen war zu diesem Zeitpunkt bereits deportiert und ermordet worden. Als die Schlacht gegen die militärisch und zahlenmäßig überlegenen Nazis begann, stand die verbliebene jüdische Bevölkerung hinter der ZOB. Der jüdische Freiheitskämpfer Marek Edelmann beschreibt die Straßenschlachten und die heldenhaften Kämpfer_innen im Buch „Das Ghetto kämpft“.
Der Widerstand der Partisan_innen in Polen aber auch in zahlreichen anderen Ländern hatte mehrere wichtige Auswirkungen. Am offensichtlichsten war der direkte Schaden, den Attentate, Überfälle und Sabotagen den deutschen Streitkräften zufügten. Die Nazis kämpften in den besetzten Gebieten gegen den Kontrollverlust, und eingesetzten Soldaten fehlten an der Front. Am wichtigsten waren die steigende Sympathie und Anhängerschaft der Partisan_innen in der Bevölkerung nach jedem erfolgreichen Kampf.
Der erfolgreiche bewaffnete Kampf gegen eine Übermacht bewirkte in den Menschen das, was Fanon an den Freiheitskämpfern in kolonisierten Ländern beschrieben hatte. Besonders dort, wo der Widerstand aus der Bevölkerung entstanden war und nicht durch Stalin oder Churchill kontrolliert wurde, machte die Befreiung nicht bei den Nazis halt.
Auch das bisherige System wurde abgelehnt. In vielen Fällen kam es zu sozialistischen Ansätzen der Selbstverwaltung. Die Siegermächte, besonders Großbritannien und Russland, taten alles dafür, diese Keimzellen der Revolution rechtzeitig zu zerstören.
Eine besondere Stellung im Partisan_innenkampf nimmt der gewaltsame Widerstand der jüdischen Bevölkerung gegen die Naziherrschaft ein. Er bedeutete eine vernichtende Niederlage der Nazi-Propaganda, die deutsche „Rasse“ sei den Juden überlegen. Auch konnten die Kämpfer_innen eindrucksvoll beweisen, dass Jüd_innen keine passiven Opfer der Vernichtungsindustrie waren. Gleichzeitig bewirkte das Umbringen der Peiniger eine Reinigung von den bis dahin erfahrenen Demütigungen und Schmerzen und Vergeltung für die vielen Todesopfer, die keine Möglichkeit gehabt hatten, bewaffneten Widerstand zu leisten.
Fragging im Vietnam-Krieg
Der Vietnam-Krieg stellt eine der größten Niederlagen des US-Imperialismus dar. Über die Dauer war er in der amerikanischen Bevölkerung immer unpopulärer geworden. Die US Army rekrutierte ihre Soldaten mithilfe rassistischer Rekrutierungsverfahren aus niederen sozialen Schichten und besonders aus der schwarzen Bevölkerung. Die höheren Offiziersränge waren meist weißen Männer aus besser gestellten Familien vorbehalten. Die Folge waren grassierender Rassismus in der Ausbildung und die Auswahl schwarzer Soldaten für besonders gefährliche Einsätze.
Nachdem das Einfliegen von immer mehr Soldaten keine sichtbaren Erfolge für die USA brachte, schlossen sich schwarze und weiße Soldaten gegen ihre Offiziere zusammen. Je länger der Krieg dauerte, desto stärker wurde der Widerstand innerhalb der Armee. Soldaten begannen, Vorgesetzten in der Nacht Handgranaten ins Zelt zu werfen, wenn ein Befehl von ihnen Verluste bedeutet hatte. Das nach der Fragmentation Granade (Splitter-Granate) benannte Vorgehen, konnte nicht nachgewiesen werden und meistens stand eine gesamte Einheit hinter den Aktionen.
Ab 1969 war Fragging schon so verbreitet, dass allein die Androhung, beispielsweise durch eine sichtbar platzierte Granate, den befehlshabenden Offizier sosehr einschüchterte, dass er keine Befehle mehr geben konnte. In den Jahren 1969 bis 1972 kam es zu knapp 900 nachgewiesenen Fragging-Aktionen, wobei durch die schwierige Nachweisbarkeit die tatsächliche Anzahl wohl weitaus höher war.
Wegen der vielen Fälle von Meuterei und der Ermordung von Offizieren durch die eigenen Soldaten wurde der Einsatz in Vietnam nach 1969 immer gefährlicher für die USA. Neben dem Verlust von Streitkräften wog der Verlust von Disziplin und Moral in der Armee noch viel schwerer. Schwarze und weiße Arbeiter hatten sich unter Waffen miteinander verbündet und die Befehlsmacht der Armee-Hierarchie mit ihrer eigenen Macht, die des Fraggings, herausgefordert. Eine Fortsetzung des Einsatzes hätte womöglich aus der Armee eine revolutionäre Kampfeinheit entstehen lassen.
Gewaltsamer Widerstand heute
Wir befinden uns in der „westlichen Welt“ derzeit in keinem offenen Krieg und die Schreckensherrschaft der Nazis und ihrer Vasallen ist seit langem beendet. Trotzdem können Menschen mit der falschen Hautfarbe, dem falschen Namen oder der falschen Religion nicht in Frieden hier leben. Institutionalisierten Rassismus gibt es in allen Staaten von Europa bis Amerika.
Besonders Rassismus gegen Schwarze hat in den letzten zwei Jahrzehnten auch in Österreich zu Toten durch Polizeigewalt geführt. Das bekannteste Opfer der langen Liste ist sicher Marcus Omofuma, der am 1. Mai 1999 durch das Zukleben von Mund und Nase durch drei Polizisten auf dem Abschiebeflug erstickte.
Ebenfalls erstickt wurde George Floyd in den USA vom Polizisten Derek Chauvin am 25. Mai letztes Jahr. Erst vor kurzem wurde dieser wegen Mordes an Floyd zu 22,5 Jahren verurteilt. Dieses Urteil gegen einen weißen Polizisten ist historisch in seiner Härte, denn meistens kamen die Mörder in Uniform mit einem blauen Auge davon. Der Grund für das rasche und eindeutige Urteil waren die fantastischen Proteste im Sommer 2020 nach der Ermordung George Floyds. Wochenlang gingen in den USA wütende Jugendliche auf die Straße, die auch gewaltsam protestierten, rassistische Statuen abrissen und Polizeistationen anzündeten.
Die Macht der gewaltsamen Aufstände zeigte nicht nur bei der Verurteilung Chauvins ihre Wirkung. Über eine der wichtigsten Forderungen von Black Lives Matter, die Abschaffung der Polizei, wird offen diskutiert.
Für oder wider die Gewalt
Es ist keine Frage der Menschlichkeit oder der Moral, ob Gewalt gegen Aufständische eingesetzt wird. Gewalt von oben wird nicht nur als Bestrafung für Gewalt von unten eingesetzt. Sie dient als Mittel, um Widerstand zu brechen und eine Herausforderung der Macht zu verhindern. Aus diesem Grund darf es auch für uns Sozialist_innen keine Frage der Moral sein, ob wir Gewalt als Mittel im Kampf für eine klassenlose Gesellschaft einsetzen.
Gewaltlosigkeit als politische Haltung kann das Ziel, Kapitalismus zu überwinden und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, nicht erreichen. Ziviler Ungehorsam und Streikbewegungen können viele Menschen in Bewegung bringen, was Gandhi bewiesen hat. Die Basis, auf der das Unrechtssystem steht, bleibt aber unangetastet, solange die Machtfrage gar nicht gestellt wird.
So wichtig große Streikbewegungen sind, als alleiniges Mittel zur Abschaffung von Kapitalismus reichen sie nicht aus. Pazifist_innen sehen sie als wichtiges Werkzeug für das Erkämpfen von Reformen und können sie leicht vereinnahmen.
Eine Protestbewegung wird den Herrschenden aber dann gefährlich, wenn sie nicht mehr davor zurückschreckt, die Staatsgewalt, beispielsweise die Polizei, zu konfrontieren. Es erfordert Entschlossenheit und den Einsatz des eigenen Körpers, um nicht nur einen faulen Kompromiss zu erreichen, sondern für tatsächliche Verbesserungen zu kämpfen. Jeder bis zum Ende geführte Kampf bringt eine Bewegung nach vorne, während von der Führung ausgehandelte Reformen meist die Passivität der Aufständischen bedeuten.
Wie die Beispiele der antikolonialen Kämpfe zeigen, endet die Befreiung von einer kapitalistischen Besatzungsmacht nicht automatisch in einer sozialistischen Gesellschaft. Oft ändert sich nur das Unterdrückungsregime. Gewalt alleine ist kein Garant für eine erfolgreiche Revolution. Es braucht eine sozialistische Perspektive und die Führung des Widerstandes durch die Arbeiter_innenklasse.
Fanon sah bereits die Gefahr, dass nach dem erfolgreichen Befreiungskampf das Machtkonstrukt nicht gestürzt, sondern nur die Personen an der Spitze gegen Indigene getauscht würden. Er schloss richtig, dass Menschen im Kampf für eine gemeinsame Sache zusammengeschweißt werden, aber Gewalt an sich konnte diese Rolle nicht einnehmen.
Erfolg nur mit der Armee
Ein Blick auf die Revolutionen nach dem ersten Weltkrieg in Russland, aber auch in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern zeigt das Potential einer revolutionären Bevölkerung, die vor Gewalt nicht zurückschreckt. Als Soldaten im Krieg mussten die vormaligen Arbeiter ihre Scheu vor Gewaltanwendung ablegen und konnten nach ihrer Rückkehr mit einer neuen Entschlossenheit die unterdrückenden Regime bekämpfen. Es waren diese mutigen Kämpfe, die Grundlage für alle großen Fortschritte der Arbeiter_innenbewegung waren.
Eine erfolgreiche Revolution wie die Russische Revolution im Oktober 1917 benötigt neben der massenhaften Beteiligung der Arbeiter_innen, eine massenhafte Militanz und Bereitschaft, mit Waffengewalt dafür zu kämpfen. Nur dann kann das Gewaltmonopol des Staates herausgefordert und gebrochen werden. Erst wenn Teile der Armee in das revolutionäre Lager überlaufen, weil sie nach der Revolution auf der Seite der Sieger stehen wollen, kann die Revolution siegen.
Der russische Revolutionär Leo Trotzki hielt diese Notwendigkeit in seinem Buch „Die Russische Revolution 1905“ fest: „Bei alledem kann natürlich von einem militärischen Siege der Aufständischen über die Regierungstruppen keine Rede sein. An materieller Kraft sind diese den Aufständischen unstreitbar weit überlegen, und im Grunde wird es sich stets nur um die Stimmung und die Haltung der russischen Soldaten handeln. […] Es [ist] die größte Illusion, wenn man annehmen wollte, dass der „Übertritt der Armee zum Volk“ sich in der Form einer friedlichen Manifestation vollziehen könne.“
Gewalt im Zuge von Arbeitskämpfen, Aufständen gegen diktatorische Regime oder gegen Rassismus muss von Sozialist_innen als Schritt in die Richtung einer sozialistischen Revolution gefeiert werden.

Jetzt das neue Linkswende-Magazin abonnieren!
➜ Alle Infos
➜ Zum Abo